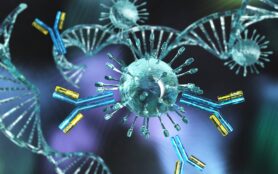Inhaltsverzeichnis
Die Henle-Schleife ist ein zentraler Bestandteil des Nephrons – der funktionellen Einheit der Niere. Sie spielt eine entscheidende Rolle bei der Regulierung des Wasser- und Elektrolythaushalts im Körper. Durch ihre einzigartige Struktur und den durch sie verursachten Gegenstrommechanismus ermöglicht sie die Konzentrierung des Urins. Dafür resorbiert sie Wasser und Salze gezielt und gibt sie an anderer Stelle ab. Dieser Prozess ist nicht nur für die Aufrechterhaltung des Blutvolumens und Blutdrucks von Bedeutung, sondern auch für die Ausscheidung von Abfallprodukten. Störungen der Funktion der Henle-Schleife können zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen führen, wie zum Beispiel beim Bartter-Syndrom oder in Zusammenhang mit der Wirkung von Schleifendiuretika. In diesem Artikel wird die Struktur, Funktion und klinische Bedeutung der Henle-Schleife genauer betrachtet.
Inhaltsverzeichnis
Henle-Schleife – Definition
Die Henle-Schleife ist ein Abschnitt des Nephrons in der Niere, der eine zentrale Rolle bei der Konzentrierung des Urins und der Rückresorption von Wasser spielt. Sie besteht aus drei funktionell unterschiedlichen Anteilen:
- der Pars recta des proximalen Tubulus, ihr dünner absteigender Teil
- dem Intermediärtubulus
- der Pars recta des distalen Tubulus, ihr dicker aufsteigender Teil
Sie erzeugt durch den Gegenstrommechanismus ein hyperosmolares Milieu im Nierenmark, was für die effektive Rückresorption von Wasser und die Konzentrierung des Urins notwendig ist.
Henle-Schleife – Anatomie und Aufbau
In ihrem Aufbau erinnert die Henle-Schleife stark an den Zug einer Posaune, der von der Nierenrinde in deren Mark reicht und die Grenze zum äußeren (Übergang in die Pars recta des proximalen Tubulus) sowie zum inneren Mark (Übergang von Intermediär- zu distalem Tubulus) markiert. Manchmal wird sie auch mit einer Haarnadel verglichen. Letztendlich kehrt sie aber mit ihrem dicken Teil zum Glomerulus zurück.
Histologie der Henle-Schleife
Die Histologie der Henle-Schleife ist für ihre einzelnen Teile charakteristisch und verrät viel über die Funktionen der einzelnen Tubulus-Abschnitte. Besonders auffällig sind die Rohre des proximalen Tubulus – auch Hauptstück genannt – die über ein dickeres, isoprismatisches Epithel mit kugelförmigen Kernen verfügen. Durch einen innen liegenden Bürstensaum erscheint das Epithel noch dicker, was das Lumen verjüngt. Der hohe energetische Umsatz wird unter dem Mikroskop sichtbar – durch eine stark eosinophile Färbung und sichtbare basale Streifen, die durch eine hohe Anzahl an Mitochondrien entsteht. Darüber hinaus lassen sich Vesikel zur Endozytose von harnpflichtigen Substanzen, die im Glomerulus nicht gefiltert werden, beobachten. Die Grenzen zwischen den einzelnen Zellen sind schwer erkennbar, was die starke Verzahnung durch Tight-Junctions zeigt.
Der Intermediärtubulus ist weniger auffällig und kann leicht mit den parallel verlaufenden Kapillaren verwechselt werden. Er hat einen deutlich kleineren Durchmesser, dafür ist sein Lumen jedoch größer. Die Epithelzellen sind platt und haben einen Kern, der an eine Linse erinnert und teilweise ins Lumen hineinragt. Mikrovilli sind kaum zu sehen und auch eine Streifung ist hier nicht vorhanden.
Der distale Tubulus oder das Mittelstück bildet eine Mischung aus den beiden vorherigen Abschnitten und verfügt über ein etwas niedrigeres isoprismatisches Epithel ohne Bürstensaum, dafür mit kleineren Mikrovilli. Sie haben deutlichere Zellgrenzen und ein helleres Zytoplasma. Eine basale Streifung ist jedoch vorhanden.

Henle-Schleife – Funktion und Resorption
Die Henle-Schleife dient der Konzentrierung des Urins, indem sie Wasser im absteigenden Schenkel resorbiert und Salze im aufsteigenden Schenkel aktiv transportiert.
Gegenstromprinzip
Das Gegenstromprinzip in der Henle-Schleife ermöglicht die effiziente Rückresorption von Wasser und Salzen. Der absteigende Schenkel ist wasserpermeabel, der aufsteigende jedoch nicht, dafür werden hier aktiv Salze ins Gewebe transportiert. Dieser gegenläufige Transport schafft einen osmotischen Gradienten, der die Rückresorption von Wasser im absteigenden Schenkel und die Abgabe von Salzen im aufsteigenden Schenkel fördert. Durch den entstandenen Gradienten kann im Sammelrohr aus dem zunächst gering konzentrierten Harn viel mehr Wasser passiv austreten als ohne den Gradienten.
proximaler Tubulus (dünner absteigender Teil)
Die Resorption in der Pars recta des proximalen Tubulus erfolgt unter anderem durch viele aktive und passive Transporter. Seine wichtigste Funkton ist die Rückresorption von Wasser über sogenannte Aquaporine. Um diesen passiven Transport zu ermöglichen, transportiert eine Natrium-Kalium-ATPase Elektrolyte aus den Zellen in die extrazelluläre Matrix. Für diesen aktiven Transport sind die vielen Mitochondrien nötig, um neue Energie in Form von ATP zu liefern.
Auf der luminösen Seite der Zellen finden sich ebenfalls unterschiedliche Natrium Transporter, die Na vom Lumen in die Zelle transportieren. Hierbei findet der elektronenneutrale Austausch von Natrium und Wasserstoff (Antiport) statt. Gleichzeitig gibt es auch Symportcarrier, die unter anderem Aminosäuren, Phosphat und Glukose (SGLT1) gemeinsam mit Natrium in die Zellen holen. Durch dieses Phänomen entsteht ein transepitheliales Potential, das zum Lumen hin negativ ist. Entsprechend der Ladung sorgt dieses dafür, dass Chlorid-Ionen aus dem Lumen resorbiert werden. Hierbei wird Wasser mitresorbiert, das wiederum durch den sogenannten solvent drag weitere Ionen mit rückresorbiert.
Diabetes und die Henle-Schleife
Bei Diabetes mellitus führt der erhöhte Blutzuckerspiegel zu einer gesteigerten Glukoseausscheidung im Primärharn, was osmotisch Wasser in den Tubulus zieht und die Rückresorption in der Henle-Schleife erschwert. Dies kann die Fähigkeit der Henle-Schleife beeinträchtigen, den Urin zu konzentrieren, da mehr Flüssigkeit im Tubulus verbleibt. Langfristig können diabetische Nierenschäden (diabetische Nephropathie) die Funktion der Henle-Schleife weiter beeinträchtigen, was zu einer fortschreitenden Verschlechterung der Nierenfunktion führt.
distaler Tubulus (dicker aufsteigender Teil)
Im aufsteigenden Teil der Henle-Schleife, insbesondere im dicken aufsteigenden Ast, werden Salze wie Natrium (Na⁺), Kalium (K⁺) und Chlorid (Cl⁻) aktiv resorbiert. Dieser Abschnitt ist wasserundurchlässig, sodass keine Wasserresorption stattfindet. Der wichtigste Transporter in diesem Prozess ist der Na⁺/K⁺/2Cl⁻-Cotransporter (NKCC2), der diese Ionen aus dem Tubuluslumen in die Tubuluszellen transportiert. Natrium wird anschließend über die Na⁺/K⁺-ATPase ins Blut abgegeben, während Kalium größtenteils wieder in das Lumen zurückdiffundiert. Durch diesen Prozess wird der Harn zunehmend verdünnt, und ein osmotischer Gradient im Nierenmark aufgebaut, der später zur Wasserresorption in den Sammelrohren beiträgt.
Henle-Schleife – Klinik
Die klinische Bedeutung der Henle-Schleife hat verschiedene Seiten, sowohl was Krankheiten betrifft, als auch Therapieansätze bei nierenfernen Beschwerden.
Bartter-Syndrom
Das Bartter-Syndrom ist eine seltene, genetisch bedingte Erkrankung, die durch eine Störung des Elektrolythaushalts im aufsteigenden Teil der Henle-Schleife verursacht wird. Es resultiert aus Mutationen in Genen, die für wichtige Transportproteine wie den NKCC2, den Kaliumkanal (ROMK) oder den Chloridkanal (ClC-Kb) codieren. Diese Defekte führen zu einer verminderten Rückresorption von Natrium, Kalium und Chlorid, was einen Verlust dieser Elektrolyte über den Urin zur Folge hat. Typische Symptome sind Hypokaliämie (niedriger Kaliumspiegel), metabolische Alkalose und Dehydratation. Das Bartter-Syndrom kann zu Wachstumsstörungen und Muskelkrämpfen führen, und die Behandlung konzentriert sich auf den Ausgleich des Elektrolytverlusts durch Supplementierung und Medikamente.
Schleifendiuretika
Sogenannte Schleifendiuretika (im Volksmund als “Wassertablette” bekannt) setzen am NKCC2 Transporter an und blockieren ihn. Durch diese Hemmung verbleiben mehr Elektrolyte im Tubulus, was eine verstärkte Ausscheidung von Wasser im Urin zur Folge hat, da Wasser osmotisch den Elektrolyten folgt. Schleifendiuretika wie Furosemid und Torasemid verwenden Mediziner, um überschüssiges Wasser aus dem Körper zu transportieren. Sie kommen bei der Behandlung von Herzinsuffizienz, Nierenversagen oder auch Bluthochdruck zum Einsatz. Die Medikamente wirken stark und schnell, können aber auch Nebenwirkungen wie Elektrolytstörungen (z.B. Hypokaliämie) und Dehydration verursachen, weshalb eine sorgfältige Überwachung nötig ist. Manchmal kann die Anwendung alternativer Medikation – wie Kaliumsparende Diuretika – sinnvoll sein.
Häufige Fragen
- Was gehört zur Henle-Schleife?
- Was macht die Henle-Schleife?
- Was wird in der Henle-Schleife resorbiert?
- Was ist das Gegenstromprinzip der Niere?
Zur Henle-Schleife gehören der absteigende Schenkel, der Wasser resorbiert, und der aufsteigende Schenkel, der Salze zurückführt. Beide Schenkel bilden zusammen eine U-förmige Struktur im Nephron. Der dicke aufsteigende Ast ist besonders wichtig für die aktive Rückresorption von Natrium, Kalium und Chlorid.
Die Henle-Schleife konzentriert den Urin, indem sie Wasser im absteigenden Schenkel resorbiert und Salze im aufsteigenden Schenkel zurückführt. Dadurch wird ein osmotischer Gradient im Nierenmark aufgebaut, der die Rückresorption von Wasser im Sammelrohr fördert. So trägt die Henle-Schleife zur Regulation des Flüssigkeits- und Elektrolythaushalts im Körper bei.
In der Henle-Schleife wird Wasser im absteigenden Schenkel und Natrium, Kalium sowie Chlorid im aufsteigenden Schenkel resorbiert. Diese Prozesse tragen zur Konzentrierung des Urins und zur Regulierung des Elektrolyt- und Flüssigkeitshaushalts bei.
Das Gegenstromprinzip der Niere beschreibt den Mechanismus, durch den in der Henle-Schleife und den umgebenden Gefäßen ein osmotischer Gradient entsteht, der die effektive Rückresorption von Wasser und Elektrolyten ermöglicht. In der Henle-Schleife fließt der Primärharn im absteigenden Schenkel nach unten, während im aufsteigenden Schenkel die Flüssigkeit in die entgegengesetzte Richtung transportiert wird. Dieser gegenläufige Fluss sorgt dafür, dass im absteigenden Schenkel Wasser aus dem Tubulus ins umliegende Gewebe resorbiert wird, während im aufsteigenden Schenkel Salze aktiv zurück ins Blut transportiert werden, ohne dass Wasser folgt. Dadurch wird der Urin konzentriert, und ein hyperosmolares Milieu im Nierenmark wird aufrechterhalten, das für die spätere Wasserresorption im Sammelrohr entscheidend ist.
- Kurtz A, Wagner C. Resorption und Sekretion von Stoffen durch die Tubuluszellen. In: Behrends J, Bischofberger J, Deutzmann R, Ehmke H, Frings S, Grissmer S, Hoth M, Kurtz A, Leipziger J et al., Hrsg. Duale Reihe Physiologie. 4., unveränderte Auflage. Stuttgart: Thieme; 2021.
- Rassow J. Funktionen der Henle-Schleife. In: Rassow J, Netzker R, Hauser K, Hrsg. Duale Reihe Biochemie. 5. vollständig überarbeitete Auflage. Stuttgart: Thieme; 2022.
- Schulte E. Feinbau und funktionelle Gliederung der Niere. In: Aumüller G, Aust G, Conrad A, Engele J, Kirsch J, Maio G, Mayerhofer A, Mense S, Reißig D et al., Hrsg. Duale Reihe Anatomie. 5., korrigierte Auflage. Stuttgart: Thieme; 2020.
Schwegler J, Lucius R. Henle-Schleife. In: Schwegler J, Lucius R, Hrsg. Der Mensch – Anatomie und Physiologie. 7., überarbeitete Auflage. Stuttgart: Thieme; 2021. - Silbernagl S. Resorption in der Henle-Schleife. In: Pape H, Kurtz A, Silbernagl S, Hrsg. Physiologie. 9., vollständig überarbeitete Auflage. Stuttgart: Thieme; 2019.
- Veelken R, Ditting T. Henle-Schleife. In: Arastéh K, Baenkler H, Bieber C, Boesecke C, Brandt R, Bruns B, Bugaj T, Chatterjee T, Ditting T et al., Hrsg. Duale Reihe Innere Medizin. 5., vollständig überarbeitete Auflage. Stuttgart: Thieme; 2024.
- Resorption und Sekretion im Tubulus, https://viamedici.thieme.de/... (Abrufdatum 05.10.2024)