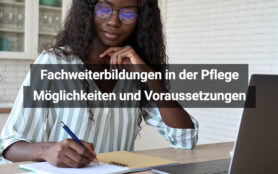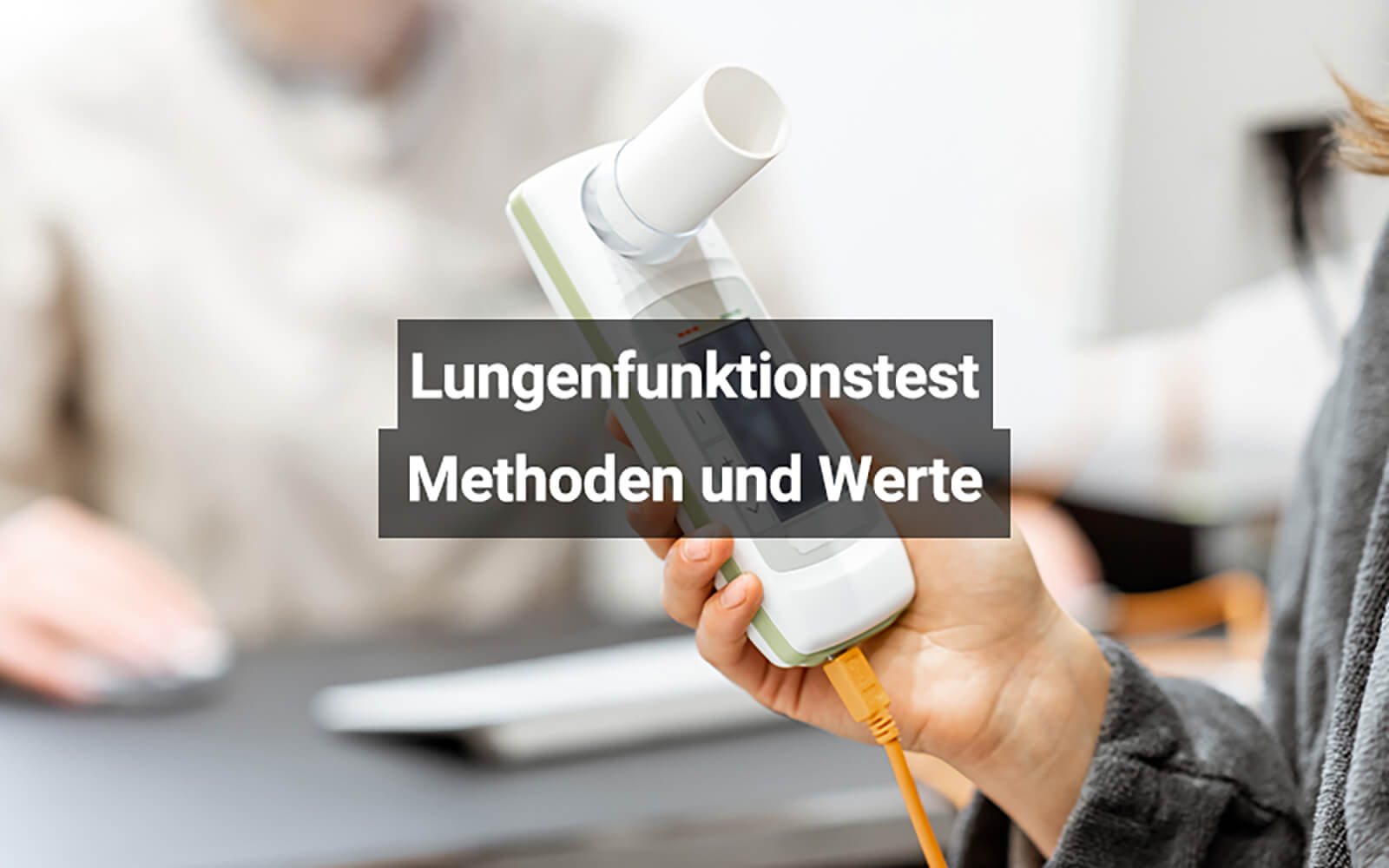
Inhaltsverzeichnis
Der Lungenfunktionstest, kurz als “Lufu” bezeichnet, gehört zu den grundlegenden diagnostischen Methoden der Lungenheilkunde. Er gibt Aufschluss über Zustand, Funktion und Leistungsreserve der Lunge. Gemessen wird, wie viel Luft Patienten/-innen ein- und wieder ausarbeiten können. Auf diese Weise lassen sich verschiedene Lungenkrankheiten diagnostizieren, etwa Asthma oder COPD (chronisch obstruktive Lungenerkrankung). Weiterhin dient der Lungenfunktionstest der Behandlungskontrolle und zeigt, ob eine gewählte Therapie anschlägt.
Details zu den verschiedenen Methoden, den ermittelten Werten und deren Interpretation liefert diese Praxisanleitung.
Inhaltsverzeichnis
Lungenfunktionstest – Methoden
Es gibt verschiedene Methoden einen Lungenfunktionstest, oder auch Lungenfunktionsprüfung genannt, durchzuführen. Die meisten Testverfahren finden in der Arztpraxis oder in der Klinik statt. Die Peak-Flow-Meter-Messung können Patienten/-innen dagegen auch zuhause durchführen. In den nachfolgenden Abschnitten werden die verschiedenen Varianten näher erläutert.
Spirometrie
Die Spirometrie wird auch als kleiner Lungenfunktionstest bezeichnet. Sie gibt Aufschluss darüber, ob eine Atemwegsobstruktion vorliegt und ob eventuell weitere Tests notwendig sind. Durchgeführt wird sie mithilfe eines sogenannten Spirometers. Dieses Gerät zeichnet die ruhige Atmung sowie die maximale Ein- und Ausatmung auf. Patienten/-innen erhalten dabei eine Klammer auf die Nase gesetzt und atmen in ein Mundstück.
Durch die Spirometrie lassen sich dynamische Veränderungen der Lungenfunktion feststellen. Sie wird daher auch zur Überprüfung der Behandlung eingesetzt.
Bodyplethysmographie
Die Bodyplethysmographie oder Ganzkörperplethysmographie nennt man in der ärztlichen Praxis auch den großen Lungenfunktionstest. Mit dieser Methode lassen sich Parameter bestimmen, die mittels Spirometrie nicht ermittelbar sind. Beide Verfahren werden häufig auch kombiniert.
Bei der Bodyplethysmographie sitzen Patienten/-innen in einer geschlossenen, gläsernen Kammer, deren Volumen bekannt ist. Sie atmen durch einen Schlauch ein und aus und führen dabei unter Anleitung des/-r Arztes/Ärztin verschiedene Tests durch. Die Atembewegungen verändern dabei den Druck in der Kammer. Ein Sensor misst diese Veränderungen. Aus den Messwerten lassen sich dann die entgegengesetzten Druckveränderungen im Brustkorb und den Lungenbläschen ableiten. Gleichzeitig findet hierbei eine Aufzeichnung des Atemstroms statt.
Darstellung der Ergebnisse
Die Darstellung der Messwerte der Bodyplethysmographie erfolgt als Druck-Volumen-Diagramm (Atemschleife). Unterschiedliche Lungenkrankheiten weisen dabei jeweils eine für diese Krankheit charakteristische Atemschleife auf.
Inhalativer Provokationstest
Der inhalative Provokationstest soll herausfinden, wie empfindlich die Atemwege reagieren. Patienten/-innen atmen beim Provokationstest einen Stoff ein, der deren Atemwege verengt. Meist wird hier Histamin eingesetzt, ein körpereigener Stoff, der an allergischen Reaktionen beteiligt ist. Bei Verdacht auf bestimmte Allergien kann auch direkt das jeweilige Allergen zur Anwendung kommen. Patienten/-innen atmen die Stoffe in unterschiedlichen Konzentrationen ein. Per Lungenfunktionstest wird dann ermittelt, wie sich bestimmte Werte beispielsweise durch das Einatmen von Histamin verändert haben.
Bronchospasmolysetest
Der Bronchospasmolysetest funktioniert ähnlich wie der Provokationstests. Bei diesem Verfahren prüft man, ob sich die Lungenfunktion unter Einfluss bestimmter Medikamente verändert. Dadurch lässt sich unter anderem feststellen, welche Arzneimittel besonders gut zur Behandlung einer Lungenerkrankung geeignet sind.
Zunächst ermittelt der/die Arzt/Ärztin die Lungenfunktionswerte im Ruhezustand. Anschließend inhalieren Patienten/-innen das entsprechende Medikament. Nach zehn bis 30 Minuten Wartezeit findet eine erneute Messung der Lungenfunktion statt.
Peak-Flow-Messung
Die Peak-Flow-Messung kann im Gegensatz zu den anderen Lungenfunktionstests, die die Mitarbeit der Patienten/-innen voraussetzen, auch mit sehr jungen Patienten/-innen wie Kindern durchgeführt werden. Ein kleines Gerät, das Peak-Flow-Meter, misst hierbei die Geschwindigkeit, mit der die Luft beim Ausatmen aus der Lunge strömt. Bei entzündeten und verengten Bronchien strömt die Luft zum Beispiel langsamer als bei einer gesunden Lunge.
Die erste Peak-Flow-Messung erfolgt dabei unter ärztlicher Anleitung in der Praxis oder Klinik. Anschließend können Patienten/-innen diesen Test auch zuhause anwenden. Im Idealfall wird die Peak-Flow-Messung zweimal täglich durchgeführt, morgens und abends. Dabei werden je drei einzelne Messungen vorgenommen und der beste Wert in einer Tabelle notiert.

Lungenfunktionstest – Durchführung
Die Durchführung der verschiedenen Lungenfunktionstest ist abhängig von der jeweiligen Methode und unterscheidet sich daher entsprechend. So umfasst die Durchführung einer Spirometrie beispielsweise drei Phasen:
- Aufklärung und Vorbereitung
- Durchführung
- Nachbereitung und Besprechung der Ergebnisse
Tipps und Hinweise
Damit der Lungenfunktionstest aussagekräftige Ergebnisse liefert, müssen Patienten/-innen den Anweisungen des/-r Arztes/Ärztin genau Folge leisten. Diese sollten sich daher Zeit für ein ausführliches Aufklärungsgespräch nehmen und den Patienten/-innen bei der Durchführung des jeweiligen Tests einfühlsam begegnen.
Eine gute und genaue Anleitung der Patienten/-innen vermeidet darüber hinaus Fehlerquellen. Idealerweise führt man je nach Test und Möglichkeit die richtige Anwendung beispielsweise des Spirometers oder des Peak-Flow-Meters kurz vor. Bei einer Spirometrie hängen die Lungenfunktionswerte zum Beispiel von der Größe des/-r Patienten/-in ab, deshalb muss diese im Vorfeld des Tests genau ermittelt werden. Hier ist es außerdem ebenso wichtig, die Patientendaten korrekt ins Spirometer einzugeben.
Lungenfunktionstest – Werte
Die Lungenfunktionsprüfung liefert eine Reihe unterschiedlicher Werte, mit denen jeweils spezifische Aussagen getroffen werden können. Daher geben die folgenden Abschnitte eine Übersicht über die Lungenfunktionstest-Werte, deren Aussagekraft und mögliche Schlussfolgerungen.
Vitalkapazität
Die Vitalkapazität (VC) ist die Volumendifferenz zwischen maximaler Ein- und Ausatmung. Die Messung findet bei ruhiger Atmung statt. Eine verringerte VC deutet auf eine interstitielle Lungenerkrankung (Erkrankungen des Lungengerüstes) oder auf Asthma hin. Es lassen sich jedoch noch weitere Detailwerte unterscheiden:
- Die forcierte Vitalkapazität (FVC) wird gemessen, indem Patienten/-innen tief einatmen und die Luft möglichst schnell und kräftig wieder auspusten.
- Die inspiratorischen Vitalkapazität (IVC) misst, wie viel Luft Patienten/-innen nach kompletter Ausatmung maximal wieder einatmen können.
- Die exspiratorische Vitalkapazität (EVC) bezeichnet das Volumen, das Patienten/-innen nach maximaler Einatmung wieder ausatmen können.
Einsekundenkapazität
Die Einsekundenkapazität, auch als forciertes exspiratorisches Volumen (FEV1) bezeichnet, gibt an, wie viel Luftvolumen innerhalb einer Sekunde kräftig ausgeatmet werden kann. Ein verminderter Wert deutet hierbei auf verengte Atemwege hin.
Relative Einsekundenkapazität
Die relative Einsekundenkapazität (Tiffenau-Index oder FEV1/FVC) gibt an, wie viel Luft Patienten/-innen mit stärkster Anstrengung innerhalb einer Sekunde ausatmen können. Der Wert wird als FEV1 in Prozent der Vitalkapazität angegeben. Bei gesunden, jungen Erwachsenen sollte er mindestens 75 Prozent betragen, bei älteren Menschen gelten 70 Prozent als Norm. Aussagekräftig ist der Wert allerdings nur bei einer leichten Verengung der Atemwege, da bei einer schweren Verengung auch die Vitalkapazität abnimmt.
Diffusionskapazität
Die Diffusionskapazität wird gemessen, indem Patienten/-innen eine Testluft einatmen, die eine geringe und unbedenkliche Menge Kohlenmonoxid (CO) enthält. Auf diese Weise ermittelt man die Fähigkeit der Lunge zum Gasaustausch, da Kohlenmonoxid ins Blut übergeht und somit Rückschlüsse auf die Aufnahme von Sauerstoff ermöglicht.
Weitere Erhebungswerte
Neben diesen Lungenfunktions-Werten lassen sich noch weitere Erhebungswerte im Rahmen von Lungenfunktionstests ermitteln. Zu diesen gehören die folgenden Werte:
– Totalkapazität (TC): gesamtes Lungenvolumen
– Residualvolumen (RV): Luftvolumen, das nach vollständiger Ausatmung in der Lunge verbleibt
– Atemzugsvolumen (VT): Luftvolumen, das bei Ruheatmung ein- und ausgeatmet wird
– Atemminutenvolumen: Atemzugsvolumen multipliziert mit der Anzahl der Atemzüge in einer Minute
– Exspiratorisches Reservevolumen (ERV): Luftvolumen, das nach normaler Ruheausatmung zusätzlich ausgeatmet werden kann
– Inspiratorisches Reservevolumen (IRV): Luftvolumen, das nach normaler Ruheeinatmung zusätzlich eingeatmet werden kann
Lungenfunktionstest – Wertetabelle
Zur Feststellung und Auswertung des jeweiligen Lungenfunktionstests werden die gemessenen Werte den Normwerten gegenübergestellt. Welche Normwerte dabei grundsätzlich gelten fasst die Tabelle zusammen.
| Parameter | Normwert |
| Totalkapazität (TC) | 6 bis 6,5 l |
| Vitalkapazität (VC) | 4,5 bis 5 l |
| Residualvolumen (RV) | 1 bis 1,5 l |
| Atemzugsvolumen (VT) | 0,5 l |
| Inspiratorisches Reservevolumen (IRV) | 3 bis 3,5 l |
| Exspiratorisches Reservevolumen (ERV) | 1,5 l |
| forcierte Vitalkapazität (FVC) | ca. 4,5 bis 5 l |
| Einsekundenkapazität (FEV1) | über 90 % des alters- und geschlechtsspezifischen Normwerts |
| relative Einsekundenkapazität (FEV1/FVC) | über 70 % |
Ergebnisinterpretation
Für eine genaue Lungenfunktionstest Auswertung werden die ermittelten Werte in Bezug zu Geschlecht, Alter und Körpergröße des/-r Patienten/-in gesetzt. Werte außerhalb des Normbereichs geben hierbei Hinweise auf die Art der vorliegenden Lungenerkrankung. Bei obstruktiven Lungenerkrankungen, bei denen verengte Atemwege vorliegen und zu denen zum Beispiel Asthma und COPD gehören, zeigt sich typischerweise eine verringerte Einsekundenkapazität bei erhöhtem Atemwiderstand.
Restriktive Lungenerkrankungen, die mit einer reduzierten Dehnfähigkeit der Lunge einhergehen, lassen sich durch eine geringere Vitalkapazität erkennen. Eine herabgesetzte Diffusionskapazität bei reduzierter Einsekundenkapazität und erhöhtem Residualvolumen kann auf ein Lungenemphysem hindeuten.
Passende Stellenangebote im Gesundheitswesen
Wer aktuell auf der Suche nach einer neuen Stelle ist, wird bei Medi-Karriere fündig. Hier gibt es eine große Auswahl an Jobs als Gesundheits- und Krankenpfleger/in, Stellen für Pflegefachfrauen / Pflegefachmänner oder Stellenangebote als Arzt.
Häufige Fragen
- Wie lange dauert ein Lungenfunktionstest?
- Was sagt ein Lungenfunktionstest aus?
- Wann wird ein Lungenfunktionstest gemacht?
- Wie hoch muss der FEV1-Wert sein?
Die Spirometrie als Lungenfunktionstest nimmt insgesamt nur wenige Minuten in Anspruch. Zusätzliche oder andere Lungenfunktionstest können rund 30 bis 90 Minuten dauern.
Der Lungenfunktionstest kann unter anderem Aussagen darüber treffen, ob eine Atemwegsobstruktion vorliegt, wie das Bronchialsystem auf Provokation reagiert und ob die Lungenvolumina verringert sind. Im Verlaufe einer Therapie durchgeführte Lungenfunktionstest zeigen zudem, ob die Behandlung anschlägt.
Ein Lungenfunktionstest wird durchgeführt, wenn der Verdacht auf eine Erkrankung der Lunge besteht. Das kann zum Beispiel bei Atemnot, hartnäckigem Husten und ungewöhnlichen Atemgeräuschen der Fall sein. Weist ein Röntgenbild der Lunge Auffälligkeiten auf, kann zur weiteren Diagnose ebenfalls ein Lungentest angeordnet werden.
Für die Einsekundenkapazität sind größen-, alters- und geschlechtsspezifische Werte festgelegt. Für Frauen mit einer Körpergröße von 170 cm liegen die Normwerte zum Beispiel zwischen 3,69 und 2,11 Litern, bei Männern mit 180 cm Körpergröße zwischen 4,33 und 2,49 Litern. Bei gesunder Lungenfunktion sollte der FEV1-Wert bei mindestens 90 Prozent der Normwerte liegen.
1. Diffusionskapazität, www.lungenarzt-ritscher.de/diagnostik-lungen-u-bronchialheilkunde (Abrufdatum: 23.09.2022)
2. Lungenfunktionsuntersuchung, www.lungenaerzte-im-netz.de/untersuchungen (Abrufdatum: 23.09.2022)
3. Interstitielle Lungenerkrankungen, www.klinik-bethanien.de (Abrufdatum: 22.09.2022)
4. Grundlagen der Lungenfunktionsprüfung, nddmed.com/de/ (Abrufdatum 04.09.2022)