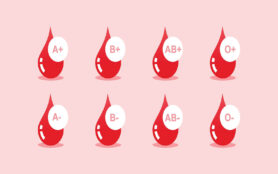Inhaltsverzeichnis
Schon seit einiger Zeit wird in Deutschland ein alarmierender Mangel an Blutplasma verzeichnet. Die Gründe dafür sind vielfältig: sinkende Spendenraten, steigender Bedarf an Plasma-basierten Medikamenten und die Herausforderungen internationaler Lieferketten. Der flüssige Bestandteil des Blutes wird mehr und mehr zur wertvollen Ressource. Und welche Folgen hat das? Wofür verwendet man Blutplasma überhaupt? Mehr zu den vielfältigen Gründen der Plasma-Knappheit, dem Einsatz und Lösungsversuchen im Artikel.
Inhaltsverzeichnis
Warum es jetzt zu wenig Blutplasma gibt
Wie so viele aufkommende Schwierigkeiten im Gesundheitsbereich ist auch der Mangel an Blutplasma ein multifaktorielles Problem. Die Spendebereitschaft in Deutschland hat in den letzten zehn Jahren deutlich abgenommen, wobei vor allem die Vollblutspenden zurückgehen. Dabei sind es unter anderem die Erstspendenden, die Jahr um Jahr wegfallen. Auch, weil Blutspende-Aktionen an Schulen zurückgegangen sind und in COVID-Zeiten überhaupt nicht stattfinden konnten. Vor allem durch die Pandemie fielen gleichzeitig bei vielen Menschen, die zuvor regelmäßig zur Spende gingen, Routinen weg.
Spenden junge Menschen zu wenig Blut? Zahlen und Fakten
Die Spendebereitschaft und die Überwindung zur Erstspende geht in den letzten Jahren deutlich zurück. Tatsächlich gehören die 18- bis 25-Jährigen traditionell gemeinsam mit einer weiteren Altersgruppe um 50 Jahre aber zu den spendefreudigsten Jahrgängen. Eine repräsentative Umfrage der BZgA von 2018 ergab, dass sie mit 56 Prozent in den letzten zwölf Monaten deutlich häufiger gespendet hatten, als andere Altersgruppen. Das Problem: Diese Jahrgänge sind deutlich geburtenschwächer als höhere Altersgruppen. Letztere (gerade die "Boomer-Jahrgänge") kommen aber langsam in ein Alter, in dem Spenden und gerade auch Plasmaspenden wieder gehäuft benötigt werden. In absoluten Zahlen reicht die Spendebereitschaft der Jungen also dennoch nicht aus, um den Bedarf zu decken.
Das durchschnittliche Alter bei der ersten Spende liegt aktuell bei 29, das Durchschnittsalter der aktiv Spendenden bei 46 Jahren. Obwohl rein rechtlich betrachtet seit letztem Jahr keine maximale Altersgrenze mehr gibt, fallen trotzdem in den höheren Altersgruppen immer mehr spendenbereite Menschen weg, da sie durch Krankheiten nicht mehr Spenden dürfen oder sich generell zu alt fühlen. Das betrifft unter anderem auch die geburtenstarken Boomer-Jahrgänge.
Gleichzeitig steigt auch der Bedarf an FFP für Medikation. Neue Therapieoptionen erfordern zusätzlich mehr Plasma. Zudem leidet der Austausch von Plasmaprodukten zwischen verschiedenen Ländern, da die Lieferketten – wie von anderen Medikamenten auch – durch lokale und globale Krisen gestört sind.
Rettungssanitäter/in Stellenangebote
Blutplasma – Dafür ist es wichtig
Wenn wir im Allgemeinen von „Blutplasma“ reden, handelt es sich um therapeutisches Plasma, Fresh Frozen Plasma (FFP) oder Gefrorenes Frischplasma (GFP) genannt, das aus der Blutspende gewonnen, auf Erkrankungen untersucht und mindestens vier Monate gefroren gelagert wurde. Es besteht zu 90 Prozent aus Wasser und zu zehn Prozent aus den in gesundem Blut vorkommenden Proteinen (Eiweiße). Hierzu gehören beispielsweise Antikörper, Albumin, Fibrinogene und Gerinnungsfaktoren, die man auch isoliert therapeutisch einsetzen kann.
Wichtige Indikationen für den Einsatz sind beispielsweise Immunschwächen, schwere Verbrennungen und Gerinnungsstörungen. Bei massivem Blutverlust kommen auch nicht nur Erythrozytenkonzentrate (EKs) zum Einsatz, sondern ab einer gewissen menge auch FFP-Konserven, um den Verlust an Protein und Gerinnungsfaktoren auszugleichen.
So kann man Blutplasma spenden
Für die Spende von Blutplasma gibt es zwei Möglichkeiten: Zum einen kann das Plasma aus der allgemein bekannten Vollblutspende gewonnen werden. Dies erfährt nach der Entnahme eine Zentrifugation, bei der sie sich in die drei mit bloßem Auge sichtbaren Blutbestandteile aufteilt:
- die Erythrozyten
- den „Buffy coat“ (Leukozyten und Thrombozyten)
- das Blutplasma.
Letzteres lässt sich aber auch gesondert, ohne den einhergehenden Verlust von Erythrozyten und Eisen, gewinnen. Hierbei handelt es sich um die Apharesespende – speziell um die Plasmapherese. Dabei wird das Blut außerhalb den Körpers durch eine Maschine gefiltert und anschließend alle nicht gespendeten Komponenten dem Blutkreislauf rückgeführt. Beide Spendearten haben Vor- und Nachteile.
Mögliche Folgen einer Blutplasma-Knappheit
Würde es wirklich zu einer Knappheit an Blutprodukten kommen, kann dies schwerwiegende Folgen für Patienten haben, die auf plasmabasierte Medikamente angewiesen sind. Fehlt Plasma, kann dies zu Behandlungsengpässen und lebensbedrohlichen Verzögerungen führen. Kliniken müssten Patienten priorisieren, was besonders bei chronisch Kranken Probleme auslösen kann.
Lösungsansätze – Finanzielle Anreize und Sensibilisierung
Die Anreize zur Blut- und Blutplasmaspende werden in der Öffentlichkeit immer wieder diskutiert. Prinzipiell soll die Blutspendebereitschaft nicht durch finanzielle Argumente erhöht werden. Dennoch steht es den unterschiedlichen Blutspendediensten frei, Spenden durch eine Aufwandsentschädigung zu entlohnen. Dabei kann es sich um ein Essen, die Übernahme der Anreisekosten, Gutscheine oder bares Geld handeln. Gleichzeitig diskutieren die Spendedienste aber auch über andere Möglichkeiten, um mehr Menschen zur Blutspende zu bewegen. Hierzu gehören beispielsweise kostenlose Gesundheitschecks. Generell sollte die Spende von Blut und Plasma aber nicht aus eigennützigen Gründen erfolgen. Viel mehr sollte man sich bewusst machen, dass so gut wie jeder Mensch in Deutschland früher oder später in seinem Leben auf Blutprodukte angewiesen ist.
Stellenanzeigen im Gesundheitswesen
Wer auf der Suche nach einer neuen Herausforderung im Gesundheitswesen ist, findet bei Medi-Karriere vielfältige Stellenangebote für Pflegekräfte, Jobs als MFA und weitere Stellen im Blutspendedienst.
- Hallbach J, Klinische Chemie und Hämatologie, Hrsg. 4., überarbeitete Auflage. Stuttgart: Georg Thieme Verlag KG; 2019.
- Horn F, Biochemie des Menschen, Hrsg. 8., überarbeitete und erweiterteAuflage. Stuttgart, Germany: Georg Thieme Verlag KG; 2020.