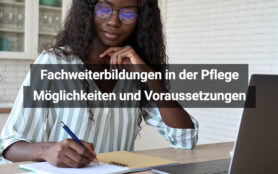Inhaltsverzeichnis
Die Bodyplethysmographie oder Ganzkörperplethysmographie ist ein Verfahren zur Bestimmung der Lungenfunktion und wird häufig auch als „große Lungenfunktion“ bezeichnet. Im Rahmen der Diagnostik liefert die Bodyplethysmographie im Gegensatz zur Spirometrie dabei genauere Informationen darüber, ob tatsächlich eine Lungenerkrankung vorliegt. Wann sie genau indiziert ist und wie diese abläuft, klärt der folgende Artikel.
Inhaltsverzeichnis
Bodyplethysmographie – Was ist das?
Die Bodyplethysmographie kommt als Teil der erweiterten Routinediagnostik bei Verdacht auf pulmonale (die Lunge betreffende) Funktionseinschränkungen zum Einsatz. Während die Spirometrie, die sogenannte „kleine Lungenfunktionsuntersuchung“, erste Hinweise auf das Vorliegen einer Lungenerkrankung liefert, kann die definitive Diagnose im Anschluss mittels Bodyplethysmographie gestellt werden. Zudem erlaubt diese Form des Lungenfunktionstests eine Differenzierung zwischen einer obstruktiven und restriktiven Ventilationsstörung.
Unter einer obstruktiven (verengenden) Ventilationsstörung versteht man hierbei eine Flussbehinderung oder Atemwegswiderstandserhöhung der Bronchien. Diese wird insbesondere exspiratorisch, das heißt bei der Ausatmung, wirksam. Zu den obstruktive Ventilationsstörung zählen zum Beispiel Asthma bronchiale und COPD (chronisch obstruktive Lungenerkrankung). Eine restriktive Ventilationsstörung, bei der die Lungenbeweglichkeit eingeschränkt ist, geht mit einem verkleinerten Lungenvolumen einher, das heißt einer kleinen Vitalkapazität und einem kleinen Residualvolumen. Die Lungenfibrose zählt beispielsweise zu dieser Form der Ventilationsstörung. Mit der Bodyplethysmographie können so folglich zusätzliche Parameter der Lungenfunktion erfasst werden, die sich mit der Spirometrie nicht messen lassen.
Bodyplethysmographie – Indikation
Die Bodyplethysmographie wird im Praxisalltag häufig parallel zur Spirometrie durchgeführt. Indikationen für die Durchführung sind dabei unter anderem:
- Allergiediagnostik
- Beschwerden wie Dyspnoe (Atemnot) oder Husten bei körperlicher Belastung und in Ruhe
- Verdacht auf eine obstruktive Ventilationsstörung: Asthma bronchiale, COPD oder chronische Bronchitis (Entzündung der Bronchien)
- Verdacht auf eine restriktive Ventilationsstörung: Lungenfibrose
- Verdacht auf ein Lungenemphysem: Komplikation von Asthma bronchiale und COPD oder bei α1-Antitrypsinmangel
Bodyplethysmographie – Durchführung
Bei der Durchführung einer Bodyplethysmographie sitzt der/die Patient/in in einer geschlossenen, luftdichten Kammer aus Glas (ähnlich einer Telefonzelle) mit einer Vorrichtung zur Druckmessung. Der Volumeninhalt der Kammer ist dabei bekannt. Der/Die Patient/in atmet über ein Mundstück, das Pneumotachometer, ruhig ein und aus und ermöglich somit die Messung.
Funktionsweise
Durch die Atembewegungen während des Tests ändert sich der Druck in der Glaskammer, was über einen Sensor gemessen werden kann. Die dabei gewonnenen Werte entsprechen der entgegengesetzten Druckveränderung in den Lungenbläschen (Alveolen) des/-r Patienten/-in. Das heißt: die Druckveränderung in der Kammer ist umgekehrt proportional zu der in den Alveolen.
Vereinfacht ausgedrückt kann man sagen, dass sich aus der synchronen Änderung des Kammer- und Alveolardrucks das intrathorakale (innerhalb der Brusthöhle gelegene) Gasvolumen (ITGV), das in etwa der funktionellen Residualkapazität (FRV) entspricht, bestimmen lässt. Hieraus lässt sich im Anschluss das Residualvolumen (RV) berechnen, welches das Gasvolumen, das am Ende der Exspiration (Ausatmung) in der Lunge verbleibt darstellt. Über den Schlauch lässt sich zudem der gesamte Atemstrom messen und aufzeichnen, der Hinweise auf einen Atemwegswiderstand liefern kann.
Unterschied zur Spirometrie
Im Gegensatz zur Spirometrie erfolgen bei der Bodyplethysmographie keine Atemmanöver wie maximale Ein-und Ausatmung. Daher ist sie für schwerkranke Patienten/-innen, denen das forcierte Ausatmen schwerfällt, besser geeignet. Außerdem ist dieser Lungenfunktionstest weniger von der Mitarbeit der Patienten/-innen abhängig. Die Methode ist allerdings zeitaufwändiger und kann bei Betroffenen, die zu Klaustrophobie neigen, anfänglich durch das Sitzen in der verschlossenen Kammer belastend sein.
Schritt für Schritt Anleitung
Eine Bodyplethysmographie kann in drei Phasen untergliedert werden – Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung. Bei der Durchführung als Hauptteil sind dabei folgende Schritte zu beachten:
- Patient/in wird in den Ganzkörperplethysmographen gesetzt.
- Über das Pneumotachometer atmet der/die Patient/in ruhig ein und aus.
- Mittels des Mikrofons werden Informationen über den weiteren Ablauf des Tests gegeben.
- Über ein Ventil im Mundstück wird zu Beginn der Einatmung die Luftzufuhr unterbrochen.
- Durch den kurzen Verschluss des Mundstücks kommt es zur Druckänderung in den Atemwegen und der Lunge, was elektronisch aufgezeichnet wird.
- Nach der Ruhigatmung kann die spirometrische Messung durchgeführt werden: der/die Patient/in erhält Atemkommandos zur tiefen Inspiration und im Anschluss daran forcierten Exspiration.
Bodyplethysmographie – Werte
Die zwei wichtigsten Messwerte, die zur genauen Differenzierung zwischen obstruktiven und restriktiven Lungenerkrankungen von Bedeutung sind, sind:
- Residualvolumen (RV): Das Residualvolumen ist bei den obstruktiven Lungenerkrankungen oft erhöht. Der/die Patient/in kann das Volumen, das eingeatmet wurde, nicht vollständig ausatmen, da entzündungsbedingte Schwellungen oder Sekrete die Atemwege verengen. Klinisch lässt sich ein sogenanntes Brummen oder Giemen bei der Ausatmung auskultieren (beim Abhorchen wahrnehmen).
- Atemwegswiderstand (Resistance, R): Die Resistance lässt sich aus der am Mundstück gemessenen Atemstromstärke und den registrierten Druckveränderungen bestimmen und entspricht der Kraft, die sich dem Gasfluss entgegenstellt. Diese Kraft ist größtenteils vom Durchmesser der Atemwege abhängig. Der Atemwegwiderstand dient auch der Erkennung von obstruktiven Lungenerkrankungen, da er dann erhöht ist.
Mit der Bodyplethysmographie als Messverfahren lassen neben diesen beiden Werten außerdem folgende Messwerte bestimmen:
- Alle Parameter der Ruhespirometrie
- Intrathorakales Gasvolumen (IGTV)
- Totale Lungenkapazität (TLC) = Volumen in der Lunge nach maximaler Einatmung
- Funktionelle Residualkapazität (FRC) = Summe aus Residualvolumen und exspiratorischem Reservevolumen, Volumen, welches nach der Ausatmung noch in der Lunge verbleibt
Die gemessenen Parameter werden als Druck-Volumen-Diagramm, eine sogenannte Atemschleife, graphisch dargestellt. Bei Lungenerkrankungen weicht die Atemschleife jeweils vom Normalbefund ab und weist für die Lungenerkrankung jeweils eine charakteristische Form auf. Bei einem/-r gesunden Patienten/-in weist die Atemschleife gerade, schmale und homogene Schleifen auf.
Restriktive Ventilationsstörungen ähneln dabei weitestgehend der normwertigen Form, besitzen allerdings eine reduzierte Vitalkapazität. Die Vitalkapazität beschreibt dabei die Volumendifferenz zwischen maximaler Ein- und Ausatmung. Die Atemschleife bei obstruktive Ventilationsstörungen ist im Vergleich zum Normalbefund durch den erhöhten Atemwiderstand abgeflacht. Ein Lungenemphysem hat die charakteristische Keulenform als Atemschleife, der exspiratorische Schleifenanteil ist deformiert.
Stellenangebote im Gesundheitswesen
Wer aktuell auf der Suche nach Stellenangeboten im Gesundheitswesen ist, wird bei Medi-Karriere fündig. Hier gibt es eine große Auswahl an Facharzt/Fachärztinnen Stellen, Medizinische Fachangestellte Jobs oder Stellenangeboten in der Krankenpflege.
- Atemwegsliga, Empfehlungen zur Ganzkörperplethysmographie, https://www.atemwegsliga.de/... (Abrufdatum: 13.09.2022)
- Thieme, Lungenfunktionsdiagnostik, https://viamedici.thieme.de/... (Abrufdatum: 16.09.2022)