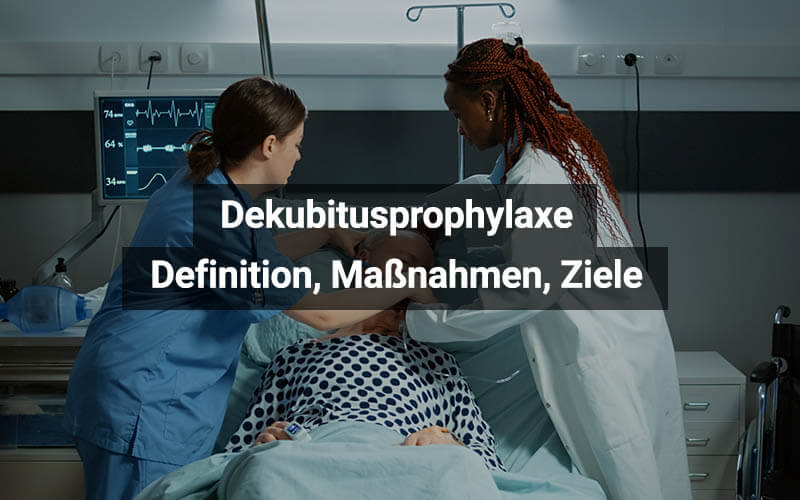
Inhaltsverzeichnis
Dekubitusprophylaxe erhält einen immer wichtigeren Stellenwert in der Pflege. Um sie richtig durchzuführen, benötigt es einiges an Fachwissen und Zeit. Die Zahl der Dekubitus-Fälle zeigt, dass die Vorbeugung von Druckgeschwüren eine der Prioritäten in der Pflege sein sollte. Denn circa 13 Prozent aller Patienten/-innen haben nach einem Aufenthalt im Krankenhaus oder einer Langzeitpflegeeinrichtung wundgelegene Stellen in verschiedenen Schweregraden. Daher ist zu schließen, dass es mehr Aufklärung und vor allem Sensibilisierung für das wichtige Thema der Dekubitusprophylaxe braucht.
Was man unter dem Begriff der Dekubitusprophylaxe versteht, welche Maßnahmen sie beinhaltet und was die genaue Zielsetzung ist, steht in diesem Artikel.
Inhaltsverzeichnis
Was ist Dekubitusprophylaxe?
Die Dekubitusprophylaxe ist eine von verschiedenen häufig gebrauchten Prophylaxen in der Pflege. Darunter versteht man die Einschätzung und Minimierung von Risikofaktoren für die Entstehung eines Druckgeschwürs. Ziel ist es, das Auftreten eines Dekubitus zu verhindern, weil dieser im fortgeschrittenen Stadium schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben und zum Entstehen weiterer Krankheiten führen kann.
Patienten/-innen, die bewegungseingeschränkt sind und viel Zeit in liegenden Positionen verbringen, sind besonders gefährdet. Es liegt an den ausgebildeten Pflegefachkräften, durch ihr Fachwissen das Risiko rechtzeitig zu erkennen und vorbeugende Maßnahmen einzuleiten. Dabei spielt vor allem die individuelle und regelmäßige Repositionierung der Patienten/-innen eine Rolle.
Allerdings sind bei der Dekubitusprophylaxe eine Vielzahl individueller Faktoren zu berücksichtigen, nach denen die Pflegefachkräfte ihre Maßnahmen richten. Den Willen des/-r Patienten/-in muss medizinisches Personal außerdem stets berücksichtigen und respektieren. Auf Wunsch bieten Pflegekräfte ihren Patienten/-innen und deren Angehörigen auch Beratung zum Thema Dekubiti an.
Wie entsteht ein Dekubitus?
Die Entstehung eines Dekubitus hängt mit verschiedenen begünstigenden Risikofaktoren zusammen. Im Allgemeinen entsteht ein Druckgeschwür durch langanhaltend verminderte Durchblutung von Haut und Gewebe. Dies ist meistens der Fall bei Patienten/-innen, die bettlägerig sind und daher lange Zeit Druck auf die selben Körperstellen ausüben. Außerdem begünstigen trockene und rissige Haut, falsche Hygiene, Mangelernährung oder Begleiterkrankungen die Entstehung eines Dekubitus.
Ein weiteres Dekubitus-Risiko sind Fehler in der Pflege, beispielsweise durch mangelnde Frühmobilisation oder falsche Lagerung. Positioniert man Menschen mit Dekubitusrisiko falsch, so dass es weiterhin eine Belastung der gefährdeten Körperstellen gibt, kann sich ein Druckgeschwür bilden oder sich ein bestehendes weiter verschlimmern. Man unterscheidet bei einem Dekubitus zwischen vier Schweregraden. Beim ersten Schweregrad ist die Haut lediglich gerötet und gereizt, von der zweiten Stufe spricht man, sobald die Blasenbildung einsetzt. Auf dem dritten Schweregrad sterben Hautschichten ab und bei der schwersten Form eines Dekubitus entzünden sich die freigelegten Knochen. Dies ist nicht nur extrem schmerzhaft, sondern auch sehr aufwendig zu behandeln.
Damit es im besten Fall zu keiner Verschlimmerung kommt oder gar nicht Druckgeschwüre entstehen, ist es wichtig, fachlich genau zur Dekubitusprophylaxe zu schulen.
Dekubitusprophylaxe – Ziele
Das Hauptziel der Dekubitusprophylaxe in der Pflege ist es, das Entstehen eines Dekubitus zu verhindern. Dazu beobachtet und erkennt man die individuellen Risikofaktoren und schaltet diese nach Möglichkeit aus oder verringert sie zumindest. Dabei ergibt sich unter Berücksichtigung der Wünsche und Bedürfnisse des/-r Patienten/-in eine individuelle Dekubitusprophylaxe, die so effektiv wie möglich ist.
Dieses Ziel kann man jedoch nur im Einklang mit den Wünschen der Patienten/-innen verwirklichen. Lehnt er oder sie Behandlungsmaßnahmen beispielsweise aufgrund von Schmerzen ab, müssen Pflegekräfte und ärztliches Personal dies respektieren. Dieser Konflikt entsteht zum Beispiel bei Patienten/-innen, die sich in der Palliativpflege befinden. Weitere Ziele, die durch man durch vorbeugende Maßnahmen erreichen kann, sind eine verbesserte Mobilität und der Schutz vor Hautschäden.
Dekubitusprophylaxe – Expertenstandard
Das Deutsche Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP) hat erstmals 2004 den Expertenstandard zur Dekubitusprophylaxe veröffentlicht. Die zuletzt aktualisierte Fassung ist aus dem Jahr 2017 und dient für die aktuelle Aufklärung zur Dekubitusprophylaxe als wichtige Orientierung. Der Expertenstandard dient der Qualitätssicherung und -entwicklung und zeigt beispielsweise wissenschaftlich gestützt auf, wie geeignet einzelne Maßnahmen zur Dekubitusprophylaxe sind.
Dies ist besonders wichtig, da ein großer Risikofaktor für das Entstehen von Druckgeschwüren oftmals Fehler in der Pflege sind. Die Schuld dafür liegt jedoch nicht bei einzelnen Fachkräften, sondern bei der mangelnden Aufklärung durch das Pflegesystem. Dem soll der Expertenstandard entgegenwirken und so maßgeblich zur Dekubitusprophylaxe beitragen.
Entstehung
Der Expertenstandard zur Dekubitusprophylaxe in der Pflege basiert auf umfassenden Literaturanalysen von sowohl nationaler, als auch internationaler Fachliteratur der Medizin und Pflege. Dabei wurden bei den aktualisierten Fassungen stets die neuesten Erkenntnisse der Forschung zur Dekubitusprophylaxe eingearbeitet. Dadurch entsteht eine wissenschaftlich basierte Grundlage für Pflegefachkräfte, um die bestmögliche Versorgung für Patienten/-innen zu gewährleisten.
Zielsetzung und Schwerpunkte
Der Expertenstandard zur Dekubitusprophylaxe setzt sich als Ziel, dass jede/r Patient/in die vorbeugenden Maßnahmen erhalten kann, die das Entstehen eines Druckgeschwürs verhindern. Dies soll zum einen durch das aktuelle Fachwissen der Pflegekräfte gewährleistet werden, aber auch durch die Ausstattung der Einrichtungen. Wenn beide Kriterien erfüllt sind, können Fachkräfte das Risiko der Patienten/-innen fachgerecht einschätzen und die angemessenen Prophylaxe-Maßnahmen einleiten. Außerdem will man Patienten/-innen und deren Angehörige aufklären, um deren Mitwirkung zum Beispiel bei Mobilitätsübungen zu verbessern.
So will man nicht nur die Zahl der Dekubitus-Fälle reduzieren, sondern auch die Mobilität von Patienten/-innen gefördert und ihre individuelle Gesundheit verbessern.
Dekubitusprophylaxe – Maßnahmen
Im Zuge der Dekubitusprophylaxe gibt es zahlreiche Maßnahmen, die das Pflegepersonal anwenden kann. Dabei haben sich in den letzten Jahrzehnten durch stetige Forschung einige herauskristallisiert, deren Wirksamkeit besonders erwiesen ist. Pflegefachkräfte, die in der Dekubitusprophylaxe geschult sind, können durch Beobachtung und Analyse der individuellen Risikofaktoren feststellen, welche Maßnahmen bei welchen Patienten/-innen geeignet sind. Einige bewährte Maßnahmen zur Dekubitusprophylaxe sind:
- Mobilisation durch Sitzen, Stehen, Gehen
- Wechsel der Lagerung je nach individuellem Bedarf
- Tägliche Kontrolle der Haut
- Hautreinigung mit geeigneten Mitteln
- Hautpflege mit geeigneten Mitteln
- Tragen atmungsaktiver Kleidung
- Einhaltung von besonderer Hygiene, beispielsweise das frühzeitige wechseln von Inkontinenzmaterialien
- Ausgewogene Ernährung
- Ausreichende Flüssigkeitsversorgung
30-Grad-Lagerung
Wie bereits erwähnt, ist die richtige Lagerung einer der wichtigsten Faktoren bei der Dekubitusprophylaxe. Laut aktuellem Forschungsstand ist dabei die sogenannte 30-Grad-Lagerung die Position, die das geringste Risiko für das Entstehen eines Druckgeschwürs bildet. Dabei liegt der/die Patient/in nahezu auf dem Rücken, was die meisten Patienten/-innen als sehr angenehm empfinden. Durch die Zuhilfenahme von Kissen wird nur jeweils eine Körperhälfte belastet, was dabei helfen kann, wenn an einer Seite bereits wundgelegene Stellen auftreten. Dennoch ist davon abzuraten, Patienten/-innen über zu langen Zeitraum ausschließlich in dieser Position zu lagern, da sich sonst auch ein Dekubitus bilden kann.
135-Grad-Lagerung
Eine weitere Form der Lagerung, die in der Dekubitusprophylaxe häufig zum Einsatz kommt, ist die 135-Grad-Lagerung. Dabei liegen Patienten/-innen halb auf der Seite und halb auf dem Bauch, wobei Kissen sie von Kissen stützen. Diese Positionierungsmöglichkeit wird ebenfalls von der Forschung unterstützt und bietet sich insbesondere dann an, wenn wunde Stellen an Rücken oder Steiß auftreten, da diese Regionen durch die 135-Grad-Lagerung entlastet werden.
90-Grad-Lagerung
Die 90-Grad-Lagerung kommt inzwischen nicht mehr in der Dekubitusprophylaxe zum Einsatz. Zwar galt sie lange als gute Positionierungsmöglichkeit und wurde am häufigsten angewendet, inzwischen sind jedoch ihre Risiken bekannt. Da man, im Gegensatz zur 135-Grad-Lagerung, nur auf der Seite und nicht auf dem Bauch liegt, wirkt zu viel Gewicht auf den Oberschenkelknochen. Dies kann gesundheitliche Probleme mit sich ziehen, weswegen man die 90-Grad-Lagerung heute nicht anwendet.
Dekubitusprophylaxe – Mobilisation
Die Mobilisation des/-r Patienten/-in ist ein weiterer großer Aspekt der Dekubitusprophylaxe. Generell gilt aktivierende Pflege als ein Grundprinzip der modernen Pflege und ist deswegen ein wichtiges Mittel bei bewegungseingeschränkten Patienten/-innen. Dabei können je nach Kraft und Mobilität des/-r Patienten/-in verschiedene Maßnahmen in Betracht gezogen werden. Bereits das aufrechte Sitzen an der Bettkante hat einen positiven Effekt und bringt den Kreislauf in Schwung. Stehen und Gehen sind ebenso förderlich bei der Dekubitusprophylaxe, da sie die Durchblutung fördern und so Druckgeschwüre vermeiden.
Dekubitusprophylaxe – Hautpflege und Hygiene
Ein weiterer Faktor, der bei der Dekubitusprophylaxe eine Rolle spielt, ist die Gesundheit der Haut und die Hygiene im Allgemeinen. Gesunde, elastische Haut wird weniger schnell wund, weswegen sie stets gut gepflegt und sanft gereinigt werden sollte. Da viele Patienten/-innen mit Risiko für Dekubitus bereits im fortgeschrittenen Alter sind, ist ihre Haut auch leichter anfällig. Daher sollte man eine besonders sanfte Reinigung mit viel Wasser und pH-neutraler Seife durchführen und nach Möglichkeit nicht täglich den gesamten Körper waschen. Das hilft dabei, den natürlichen Schutzfilm der Haut beizubehalten und so Irritationen vorzubeugen.
Bei Patienten/-innen mit Erkrankungen wie Inkontinenz kann ein spezieller Hautschutz dabei helfen, die Haut vor Reizung durch Ausscheidungen zu schützen. Außerdem sollte man die Patienten/-innen nach Möglichkeit zur Toilette führen.
Dekubitusprophylaxe – Ernährung
Die Ernährung kann nicht allein dafür sorgen, dass einem Dekubitus vorgebeugt wird. Dennoch hat eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung positive Auswirkungen auf die Genesung und kann dadurch auch zur Dekubitusprophylaxe beitragen. Es sollten also genügend Obst und Gemüse auf dem Menü in Krankenhäusern und Pflegeheimen stehen.
Dazu ist es vor allem wichtig, dass der/die Betroffene ausreichend isst und mit genügend Kalorien versorgt wird. Der Appetit kann beispielsweise durch leichte Bewegung gefördert werden. Außerdem sollte man überprüfen, dass eventuell vorliegende Schluckstörungen behandelt werden und Prothesen richtig sitzen, um eine schmerzfreie Nahrungsaufnahme zu ermöglichen. Letztlich ist für den Körper auch eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr wichtig, um gesundheitlichen Problemen vorzubeugen.
Passende Stellenangebote für Pflegekräfte
Wer aktuell noch nach passenden Stellenangeboten im Bereich Pflege sucht, findet bei Medi-Karriere eine große Auswahl, beispielsweise Jobs für Krankenpfleger/innen, Stellenangebote für Altenpfleger/innen und Kinderkrankenpflege-Jobs.
Häufige Fragen
- Was versteht man unter Dekubitusprophylaxe?
- Warum ist Dekubitusprophylaxe wichtig?
- Warum gibt es einen Expertenstandard für Dekubitusprophylaxe?
- Welche Dekubitusprophylaxe-Maßnahmen gibt es?
Unter Dekubitusprophylaxe versteht man Maßnahmen, die dem Entstehen von Druckgeschwüren vorbeugen sollen. Dabei werden je nach Patient/in individuelle Maßnahmen angewandt, die an die jeweiligen Risikofaktoren angepasst sind. Dekubitusprophylaxe findet vor allem Anwendung bei Patienten/-innen, die bewegungseingeschränkt und dadurch teilweise bettlägerig sind.
Dekubitusprophylaxe ist wichtig, um dem Entstehen von Druckgeschwüren oder der Verschlimmerung eines bereits bestehenden Dekubitus vorzubeugen. Den Schweregrad eines Dekubitus kann man in vier Stufen einteilen, die von gereizter Haut bis hin zu freiliegenden, entzündeten Knochen reichen. Daher ist es wichtig, frühzeitig zu intervenieren und präventive Maßnahmen zu ergreifen. Denn die Behandlung eines bereits vorhandenen Dekubitus ist nicht nur schwierig, sondern auch äußerst schmerzhaft.
Der Expertenstandard für Dekubitusprophylaxe hat als Ziel, jedem/-r Patienten/-in zu ermöglichen, die präventiven Maßnahmen zu erhalten, die das Entstehen eines Dekubitus verhindern. Unter anderem sollen Fachkräfte ausreichend geschult werden, um das Dekubitusrisiko einschätzen zu können. Der Expertenstandard basiert dabei auf nationaler und internationaler Fachliteratur und wird immer wieder an den neuesten Forschungsstand angepasst.
Bei den Maßnahmen zur Dekubitusprophylaxe gibt es ein breites Spektrum. Mit am wichtigsten ist dabei die korrekte Lagerung von Patienten/-innen und die Repositionierung nach einer angemessenen Zeit. Außerdem ist es wichtig, die Mobilität des/-r Patienten/-in zu fördern, um die Durchblutung anzuregen. Aber auch Hygiene und Ernährung sind Themen, die bei der Dekubitusprophylaxe Beachtung finden.
1. Expertenstandard Dekubitusprophylaxe, www.dnqp.de (Abrufdatum: 29.07.2022)
2. www.dekubitus.de/ratgeber/prophylaxe (Abrufdatum: 29.07.2022)
3. flexikon.doccheck.com/de/Dekubitusprophylaxe (Abrufdatum: 28.07.2022)










