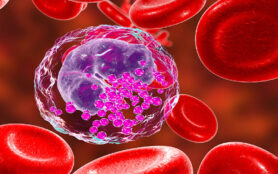Inhaltsverzeichnis
Das Antigen ist ein zentraler Bestandteil des Immunsystems, die eine Schlüsselrolle bei der Erkennung und Bekämpfung von Krankheitserregern spielen. Diese Moleküle ermöglichen dem Körper gezielt gegen infektiöse Bedrohungen vorzugehen und eine Immunantwort zu initiieren, die den Schutz und die Gesundheit des Organismus gewährleistet. Dieser Artikel beschreibt den Aufbau, die Funktion und einige klinische Aspekte dieser kleinen Strukturen.
Inhaltsverzeichnis
Antigen – Definition
Ein Antigen ist ein Molekül, das vom Immunsystem als fremd erkannt wird und eine Immunantwort auslöst. Antigene kommen häufig auf der Oberfläche von Pathogenen wie Bakterien, Viren und Pilzen vor. Sie binden an spezifische Antikörper oder T-Zell-Rezeptoren, wodurch die Abwehrmechanismen des Körpers aktiviert werden. Sie machen aber auch Teile der Oberfläche körpereigener Zellen aus.
Antigen – Aufbau
Der Aufbau kann sehr variabel sein. Allerdings besitzen sie alle sogenannte Epitope, das heißt gewisse Stellen, die von Immunzellen oder Antikörpern erkannt und gebunden werden können.
Sie können unterteilt werden in Vollantigene und Haptene. Vollantigene lösen durch Binden an einen Lymphozytenrezeptor eine spezifische Immunantwort aus. Haptene müssen durch ein weiteres Trägermolekül unterstützt werden, um eine Immunantwort auszulösen.
Antigen – Funktion
Antigene spielen immer dann eine Rolle, wenn es darum geht bei Zellen oder anderen Stoffe fremd von Körpereigen zu unterscheiden. Das macht sich der Körper nicht nur bei der Abwehr gegen Keime zu nutze sondern auch, um fremde Gewebe zu unterscheiden, weshalb das Blutgruppensystem existiert.
Antigene können von Zellen über die MHC-Rezeptoren an ihrer Oberfläche präsentiert werden. Treffen professionell antigenpräsentierende Zellen wie zum Beispiel Makrophagen auf Überreste von Keimen, nehmen sie diese per Endozytose auf und lässt sie mit Lysosomen verschmelzen. In den Lysosomen werden die Proteine verkleinert, bis sie auf den synthetisierten und bearbeiteten MHC II-Rezeptor aus dem Golgi-Apparat beladen werden. Der beladene Rezeptor wird auf der Zellmembran nach außen präsentiert, sodass T-Zellen mit einem CD4-Rezeptor mit dem MHC II Molekül reagieren und eine Immunreaktion auslösen.

Tumorzellen
Fast alle körpereigenen, kernhaltigen Zellen präsentieren MHC I Rezeptoren, um sich als körpereigen und gesund auszuweisen. Ist die Zelle infiziert oder handelt es sich bei ihr um eine tumorös entartete Zelle, produziert sie andere Proteine und präsentiert diese unter Umständen auch an der Oberfläche. Diese werden dann von natürlichen Killerzellen (NK-Zellen) und zytotoxischen T-Zellen mit dem CD8-Rezeptor als fremd erkannt und in der Regel getötet oder die Apoptose, der programmierte Zelltod, wird eingeleitet.
Blutgruppen
Die Blutgruppen des AB0-Systems basieren auf Antigenen, die Erythrozyten auf ihrer Oberfläche tragen. Es handelt sich dabei um Proteine, die eine bestimmte Abfolge von Kohlenhydraten tragen, welche die Blutgruppe bestimmt. Der Körper bildet allerdings auch Antikörper gegen andere Blutgruppen, weshalb es bei einer Blutspende mit der falschen Blutgruppe zu lebensbedrohlichen Reaktionen kommen kann.
| Blutgruppe (Antigen) | Antikörper |
| 0 | Anti-A und Anti-B |
| A | Anti-B |
| B | Anti-A |
| AB | keine |
Für die Spende bedeutet das grundsätzlich, dass Spender der Blutgruppe 0 jeder Gruppe spenden können und Menschen der Gruppe AB Blut von allen Gruppen erhalten können. Zusätzlich kann es jedoch zu Problemen kommen, da zusätzliche, kleinere Antigene weitere Blutgruppen definieren. Menschen ohne den sogenannten Rhesus-Faktor können nach Kontakt mit Blut, das den Rhesus-Faktor enthält, Antikörper gegen ihn bilden und es könnte bei einer Spende mit Rhesus-positivem Blut zu einer Transfusionsreaktion kommen.
Transplantationen
Bei Organ- oder Stammzelltransplantationen erhöht sich die Chance, dass das Organ vom Körper akzeptiert wird, je mehr Antigene auf der Organoberfläche miteinander übereinstimmen. Besonders bei Stammzellenspenden müssen die HLA-Hauptgene, die für die MHC Rezeptoren codieren, übereinstimmen. Da hier eine genetische Komponente reinspielt, hat man bei Geschwistern meist den größten Erfolg bei der Suche nach Kompatibilität.
Antigen – Klinik
Verschiedenen Antigene im Blut können als Tumormarker in der Diagnostik oder Verlaufskontrolle von Tumoren dienen. Das Prostata spezifische Antigen (PSA) wird im gesunden Gewebe in einem gewissen Maße von der Prostata produziert und ins Sperma abgegeben. Es handelt sich dabei um eine Protease, also ein Enzym, das Proteine spaltet. Dies tut es auch im Sperma und gibt so der Flüssigkeit eine Gel-artige Konsistenz. PSA-Werte erhöhen sich normalerweise mit dem Alter. Es wird vermutet, dass die zunehmende Produktion einen evolutionären Vorteil gibt, um die sinkende Fertilität mit dem Alter auszugleichen.
Prostatakarzinome stellen eigentlich nicht mehr PSA her, sondern geben es nur viel leichter über ihre Zellmembran auch an das Blut ab, was für steigende Spiegel sorgt. Dem Krebsgewebe fehlt die Basalmembran, was dazu führt, dass Stoffe wie PSA leichter ins Blut abgegeben werden können.
Die rektal digitale Untersuchung, bei der der Untersucher mit dem Finger über das Rektum versucht, die Außenzone der Prostata zu ertasten, hat eine relativ niedrige Spezifität. Der PSA-Blutwert dagegen hat eine höhere Spezifität (etwa 91%), allerdings hat er eine niedrige Sensitivität von neun bis 33 Prozent. Im Schnitt haben bis zu 91 Prozent der Männer mit erhöhtem PSA-Spiegel kein Prostata-Krebs.
Häufige Fragen
- Was macht ein Antigen?
- Wo gibt es Antigene?
- Was ist der Unterschied zwischen Antigen und Antikörper?
- Was heißt ein erhöhter PSA-Wert?
Ein Antigen aktiviert das Immunsystem, indem es als fremde Substanz erkannt wird und eine spezifische Immunantwort auslöst. Antigene, die auf der Oberfläche von Pathogenen wie Bakterien, Viren und Pilzen vorhanden sind, werden von spezialisierten Zellen des Immunsystems erkannt. Antigene werden auch von antigenpräsentierenden Zellen aufgenommen und verarbeitet. Diese Zellen präsentieren dann Teile des Antigens auf ihrer Oberfläche, wo sie von T-Zellen erkannt werden. Dies aktiviert die T-Zellen, die dann infizierte Zellen zerstören oder andere Immunzellen anleiten.
Sie befinden sich auf der Oberfläche von Krankheitserregern. Auch infizierte Körperzellen präsentieren Antigene auf ihrer Oberfläche, ebenso wie Krebszellen. Bei Transplantationen und Bluttransfusionen spielen fremde Gewebeantigene und Blutgruppenantigene eine wichtige Rolle, da sie vom Immunsystem als fremd erkannt und angegriffen werden können.
In der Umwelt finden sich Antigene in Form von Allergenen wie Pollen oder Tierhaaren, die allergische Reaktionen auslösen können.
Impfstoffe enthalten ebenfalls Antigene und stimulieren das Immunsystem, ohne eine Infektion zu verursachen, und sorgen so für eine Immunität gegen bestimmte Krankheiten.
Antigene und Antikörper sind wichtige Bestandteile des Immunsystems. Antigene sind fremde Substanzen oder Moleküle, die auf der Oberfläche von Krankheitserregern wie Bakterien und Viren vorkommen und eine Immunantwort auslösen. Antikörper sind spezialisierte Proteine, die von B-Zellen produziert werden und spezifisch an Antigene binden. Diese Bindung neutralisiert die Antigene, markiert sie für die Zerstörung oder blockiert ihre schädliche Wirkung.
Ein erhöhter PSA-Wert bedeutet, dass der Gehalt an prostataspezifischem Antigen (PSA) im Blut höher als normal ist. Dies kann verschiedene Ursachen haben, darunter Prostatakrebs, eine gutartige Prostatavergrößerung, eine Prostataentzündung oder eine kürzliche Prostata-Stimulation. Ein erhöhter PSA-Wert ist kein eindeutiger Hinweis auf Prostatakrebs, sondern signalisiert, dass weitere Untersuchungen notwendig sind.
- David MK, Leslie SW. Prostate Specific Antigen. 2022 Nov 10. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan–. PMID: 32491427.
- Blut und Blutzellen, https://next.amboss.com/... (Abrufdatum: 07.07.2024)
- Unspezifisches Immunsystem, https://next.amboss.com/... (Abrufdatum: 07.07.2024)