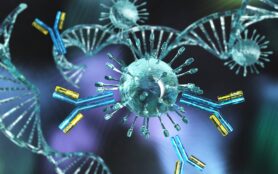Inhaltsverzeichnis
Der Blutdruck ist die treibende Kraft der Blutzirkulation im Körper. Er ist essentiell für die Versorgung aller Organe und zur Aufrechterhaltung des Kreislaufs. Dafür reguliert der Körper ihn mit einer ganzen Reihe von Mechanismen. Auffallen tut er meist jedoch erst dann, wenn Probleme auftreten. Die primäre Hypertonie – also ein pathologisch erhöhter Blutdruck in den Arterien – ist eine der häufigsten Bevölkerungskrankheiten in der westlichen Welt und kann ernste Konsequenzen mit sich bringen. Dieser Artikel zeigt einen Überblick über die Entstehung und Aufrechterhaltung des Blutdrucks, die verschiedenen Regulationsmechanismen und Erkrankungen des Blutdrucksystems auf.
Inhaltsverzeichnis
Blutdruck – Was ist das?
Blutdruck beschreibt die Kraft, mit der das Blut durch die Adern fließt und gegen die Gefäßwände drückt. Er entsteht durch das Zusammenspiel von Herzschlag und Gefäßwiderstand und sorgt dafür, dass alle Organe und Gewebe mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt werden. Dabei passt sich der Blutdruck ständig an unterschiedliche Anforderungen an – zum Beispiel steigt er bei körperlicher Anstrengung und sinkt in Ruhephasen.
Blutdruck – Physiologie und Entstehung
Im Allgemeinen setzt sich der Blutdruck aus den Funktionen verschiedener Abschnitte des Kreislaufssystems zusammen. Jeder Abschnitt erfüllt dabei eine eigene Funktion:
- Windkesselgefäße: Durch die elastische Wand der Aorta wandelt sie den pulsierenden Blutstrom aus dem Herzen in einen kontinuierlichen Blutstrom um.
- Widerstandsgefäße: Die kleinen Gefäße (Arterien und Venolen) tragen am meisten zu dem Widerstand bei, gegen den das Blut fließt. Dieser Widerstand kann durch Vasokonstriktion (Zusammenziehen der Gefäße) und Vasodilatation (Aufweiten der Gefäße) die Flussgeschwindigkeit des Blutes beeinflussen und damit die kontinuierliche Durchblutung der Organe ermöglichen (Bayliss-Effekt).
- Kapillaren: Obwohl Kapillaren an sich sehr klein sind, summiert sich ihre Durchschnittsfläche insgesamt zum größten Querschnitt im Gefäßsystem. Dadurch wird der Blutstrom sehr langsam, was den Gasaustausch im Gewebe ermöglicht.
- Kapazitätsgefäße: In den Venen befindet sich etwa 80% des zirkulierenden Blutes. Wie die Widerstandsgefäße befinden sich auch in den Venen Muskeln, die zu Konstriktion und Dilatation führen können. Damit wird jedoch weniger der Blutdruck beeinflusst, sondern bei Bedarf ein Teil des Blutes mobilisiert.
Grob betrachtet setzt sich das Blutdrucksystem aus zwei in Reihe (also hintereinander) geschalteten Systemen zusammen. Das Hochdruck- und das Niederdrucksystem.
Hochdrucksystem
Das Hochdrucksystem besteht aus dem linken Ventrikel (in der Systole) und den arteriellen Gefäße. Während des Herzzyklus wird Blut in das Hochdrucksystem ausgeworfen und entsprechend der Gefäßwände (wie oben beschrieben) manipuliert. Es entstehen eine Pulswelle und eine Stromwelle.
- Pulswelle (Druckpuls): Die Pulswelle ist die druckbedingte Ausbreitung der vom Herzen erzeugten Blutwelle entlang der Arterien. Sie entsteht mit jeder Herzaktion und bewegt sich durch das Gefäßsystem. Die Pulswellengeschwindigkeit ist von der Dichte des Bluts und dem Gefäßwiderstand abhängig. Sie ist normalerweise deutlich schneller als die Stömungsgeschwindigkeit des Bluts (etwa 5 bis 6 m/s) und nimmt in die Peripherie hin zu (8 bis 12 m/s).
- Strompuls: Der Strompuls beschreibt die rhythmische Veränderung des Blutvolumens in den Arterien, die mit jedem Herzschlag auftritt. Er spiegelt den tatsächlichen Blutstrom wider, wobei der Wert in der Systole (1 bis 1,5m/s) deutlich höher ist als in der Diastole. Herzfern ist die maximale Strömungsgeschwindigkeit deutlich geringer als zentral.
Spricht man im herkömmlichen Sprachgebrauch von „Blutdruck“ dann ist meistens der arteriell gemessene Druck in den Widerstandgefäßen in der Systole und Diastole gemeint. Er liegt normalerweise bei etwa 80mmHg (diastolisch) und steigt in etwa 300ms auf 120mmHg an (Referenziert für das junge Erwachsenenalter).
Systole und Diastole – Was ist was?
Die Systole beschreibt im Verlauf der Druckpulskurve den höchsten Punkt, also der maximale Druckwert, der beim Auswurf des Herzens erreicht wird. Der niedrigste Punkt ist entsprechend die Diastole, die in der Füllungsphase des Herzens vorliegt. Wer mehr über die Blutdruckmessung erfahren will, kann hier klicken.
Der Blutdruck als treibende Kraft für den Kreislauf lässt sich allerdings besser durch den sogenannten Arteriellen Mitteldruck (MAD) beschreiben. Dieser lässt sich aus dem systolischen (PSys) und diastolischen Blutdruck (PDia) berechnen. Für herzferne Gefäße verwendet man folgende Annährungsformel:
MAD = PDia + 1/3*(PSys – PDia)
Ziehen die Gefäße sich zusammen, wird ein Teil der Welle „reflektiert“, läuft also zurück gegen die Stromrichtung. Entsprechend der physikalischen Gesetze heben sich die beiden Stromstärken auf (der Fluss wird langsamer), ihre Drücke addieren sich aber (der Druckpuls wird größer).
Niederdrucksystem
Das Niederdrucksystem fasst grob alle Abschnitte des Kreislauf von den Kapillaren bis in den linken Vorhof zusammen. Auch der linken Ventrikel wird in der Diastole dazugezählt. Seine Hauptaufgabe besteht darin, das sauerstoffarme Blut aus dem Körper zurück zum Herzen zu transportieren und den Gasaustausch in der Lunge zu ermöglichen. Durch die hohe Dehnbarkeit der Venen kann das Niederdrucksystem große Blutmengen speichern und dient als Volumenreservoir des Kreislaufs. Der venöse Blutdruck entsteht im Stehen vor allem durch die Zusammensetzung von hydrostatischem und hydrodynamischen Druck, die durch die Schwerkraft und die Herzaktion auf das Niederdrucksystem einwirken. Am Fuß beträgt der Druck etwa 90mmHg, die Sinusvenen im Kopf haben einen Blutdruckwert von etwa -10mmHg. Im Liegen ist der hydrostatische Druck nahezu vernachlässigter, wodurch nur noch der hydrodynamische Druck durch das Herz auf das Niederdrucksystem einwirkt.
Hydrostatische Indifferenzebene
Die hydrostatische Indifferenzebene ist die Körperhöhe, an der sich der venöse Blutdruck bei Lageänderungen nicht durch hydrostatische Effekte verändert (etwas unterhalt des Zwerchfells).
Orthostase
Zusätzlich reguliert das Niederdrucksystem die venöse Rückführung des Blutes zum Herzen und beeinflusst so das Herzzeitvolumen. Mechanismen wie die Muskelpumpe, die Atmung (Sogverhältnisse im Thorax) und die Venenklappen unterstützen den Blutfluss gegen die Schwerkraft, insbesondere aus den unteren Körperregionen. Damit spielt das System eine entscheidende Rolle bei der Blutdruckstabilisierung und der Anpassung an wechselnde Kreislaufbedingungen.
Der zentralvenöse Druck (ZVD) gibt den Druck in der Vena cava superior nahe dem rechten Vorhof an und dient als Indikator für die Herzfüllung sowie das venöse Blutvolumen. Er wird invasiv mittels eines zentralvenösen Katheters gemessen und liegt normalerweise zwischen 3 und 10 mmHg. Der ZVD ist wichtig zur Beurteilung des Flüssigkeitshaushalts, der Herzfunktion und bei der Überwachung kritisch kranker Patienten, insbesondere bei Herzinsuffizienz, Schockzuständen oder Volumenmangel.
Regulation und Bedeutung für die Körperfunktion
Der Blutdruck ist von zentraler Bedeutung für die Zirkulation des Bluts und damit für den Sauerstoffaustausch, Nährstofftransport und die Ausschüttung von Transmitter und Hormonen. Damit ist er essentiell für die Aufrechterhaltung der Körperfunktion, Vigilanz und Organfunktion. Dafür muss der Körper eine Reihe von Regulationsmechanismen anwenden, die zentral durch die Formatio reticularis gesteuert werden:
Kurzfristige Regulation
Organe im menschlichen Körper müssen möglichst gleichmäßig durchblutet werden und dürfen nicht den allgemeinen Blutdruckschwankungen unterliegen. Die kurzfristige Blutdruckregulation sorgt für eine schnelle Anpassung des Kreislaufs an wechselnde Bedingungen wie Lageänderungen oder körperliche Belastung. Hauptsächlich erfolgt sie über das Barorezeptor-Reflexsystem, das in der Aorta und den Karotissinus Druckveränderungen registriert. Sinkt der Blutdruck, senden die Rezeptoren weniger Signale ans Gehirn, wodurch das vegetative Nervensystem die Herzfrequenz und Gefäßengstellung erhöht. Steigt der Blutdruck, wird der gegenteilige Effekt ausgelöst, um ihn zu senken.
Zusätzlich unterstützen hormonelle Mechanismen wie die Freisetzung von Adrenalin die kurzfristige Regulation. Dieses Hormon steigert die Herzleistung und verengt die Gefäße, um den Blutdruck stabil zu halten. Auch das venöse System trägt zur Regulation bei, indem Venen ihr Volumen verändern, um den Blutfluss zum Herzen anzupassen.

Mittel- bis langfristige Blutdruckregulation
Ist der Blutdruck durch äußere oder innere Faktoren längerfristig (über Stunden oder Tage) erhöht, wendet der Körper eine andere Form der Regulation an.
Das RAAS (Renin-Angiotensin-Aldosteron-System) reguliert den Blutdruck durch hormonelle Steuerung. Bei Blutdruckabfall schüttet die Niere Renin aus, das Angiotensin II bildet. Dieses verengt die Gefäße und stimuliert Aldosteron, wodurch die Niere Natrium und Wasser zurückhält. Dadurch steigt das Blutvolumen und der Blutdruck erhöht sich.
ADH (Antidiuretisches Hormon (auch Vasopressin) reguliert den Wasserhaushalt und den Blutdruck. Es wird im Hypothalamus gebildet und in der Hypophyse freigesetzt. ADH steigert die Wasserrückresorption in den Nieren, reduziert die Urinausscheidung und verengt die Gefäße, wodurch das Blutvolumen steigt und der Blutdruck erhöht wird.
ANP (Atriales natriuretisches Peptid) ist ein Hormon, das in den Herzvorhöfen gebildet wird und den Blutdruck sowie den Flüssigkeitshaushalt reguliert. Es fördert die Ausscheidung von Natrium und Wasser über die Nieren, erweitert die Blutgefäße und hemmt das RAAS, wodurch Blutvolumen und Blutdruck bei Ausschüttung gesenkt werden.
Blutdruck – Bedeutung in der Klinik
Die Blutdruckmessung ist bedeutend für die klinische Überwachung und Therapieoptimierung. Man kann den Blutdruck indirekt messen oder direkt. Die erstere Methode ist dabei die weitaus bekanntere, bei der der Blutstrom der Arteria brachialis durch eine Manschette unterbrochen wird, bis der Blutdruck den Manschettendruck überschreitet. Dieses nicht-invasive Verfahren findet im Alltag die häufigste Anwendung. Elektrische Blutdruckmessgeräte können auch für die Selbstmessung oder die 24h-Blutdruck-Messung verwendet werden.
Wieso eigentlich RR?
Für den Blutdruck wird in der Klinik häufig die Abkürzung „RR“ verwendet. Diese steht für den Eigennamen des Verfahrens der indirekten Blutdruck Messung: Die Messung nach Riva Rocci.
Die sehr viel genauere Methode der Blutdruckmessung ist invasiv: Die erfolgt über die direkte Einführung eines Katheters in eine Arterie, wodurch kontinuierliche und präzise Blutdruckwerte in Echtzeit gemessen werden. Sie ist beispielsweise der Standard für die Überwachung auf Intensivstation.
ABI-Score
Der ABI-Score (Ankle-Brachial-Index) ist ein diagnostischer Wert zur Beurteilung der Durchblutung in den Beinen und zur Erkennung peripherer arterieller Verschlusskrankheit (pAVK). Er wird durch das Verhältnis des systolischen Blutdrucks am Knöchel zum systolischen Blutdruck am Arm berechnet. Ein Wert unter 0,9 weist auf eine arterielle Durchblutungsstörung hin, während Werte über 1,3 auf versteifte Arterien hindeuten können. Der ABI ist eine einfache, nicht-invasive Methode zur Einschätzung des kardiovaskulären Risikos.
Blutdruck – Erkrankungen und Beschwerden
Bei einem wichtigen System wie dem Blutdruck kann es zu den unterschiedlichsten Erkrankungen kommen, die sich insgesamt negativ auf das Wohlbefinden auswirken und ernsthafte gesundheitliche Risiken mit sich bringen können.
Bluthochdruck – Arterielle Hypertonie
Arterielle Hypertonie ist eine chronische Erhöhung des Blutdrucks über 140/90 mmHg, die das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Organschäden steigert. Sie gehört zu den wichtigsten kardiovaskulären Risikofaktoren und kann die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Krankheiten wie Herzinfarkt, Schlaganfall oder auch Demenz erhöhen. Umso wichtiger ist die adäquate Behandlung der Erkrankung. Dafür ist entscheidend, ob eine primäre oder sekundäre Erkrankung vorliegt.
Die primäre Hypertonie ist eine multifaktorielle Erkrankung, hat also keine eindeutige Ursache, sondern verschiedene Faktoren, wie das Körpergewicht, die genetische Veranlagung, die Ernährung oder Stress. Die auch essentielle Hypertonie genannte Erkrankung gehört zu den häufigsten Pathologien der westlichen Welt mit einer Inzidenz von 30 bis 45%, bei über 65-Jährigen sogar mehr als 50%. Laut aktueller Leitlinie behandelt man gemäß folgendem Schema:
- Angiotensin-Konversionsenzymhemmer (ACE-Hemmer)/Angiotensin-II-Rezeptorblocker
- Kalziumkanalblocker
- Thiazid-artige Diuretika oder Thiazide
- Aldosteronantagonisten (nach spezieller Indikation)
- Alpharezeptorblocker (nach spezieller Indikation)
- Betablocker (nach spezieller Indikation)
- Kaliumsparende Diuretika (nach spezieller Indikation)
- Renin-Inhibitoren (nach spezieller Indikation)
- Schleifendiuretika (nach spezieller Indikation)
- Zentrale Alpha-2-Rezeptor-Agonisten (nach spezieller Indikation)
- Direkte Vasodilatatoren (nach spezieller Indikation)
Die sekundäre Hypertonie ist weitaus seltener (circa 10%) und auf eine Grunderkrankung zurückzuführen. Der Verdacht entsteht vor allem dann, wenn der Blutdruck medikamentös nicht einzustellen ist, oder weitere klinische Beschwerden oder auch Laborparameter auffallen. Die Ursachen können vielfältig sein. So kann die Hypertonie beispielsweise von Problemen der Niere (beispielsweise einer Nierenarterienstenose), des endokrinen Systems (durch Morbus-Cushing oder ein Phäochromozytom), des kardiovaskulären Systems (Aortenklappenstenose oder -Insuffizienz) oder der Lunge (Schlafapnoe) ausgehen. Auch Medikamente kommen als mögliche Ursache in Betracht. Die Therapie besteht primär darin, die Ursache zu detektieren und direkt zu beheben.
Wie fällt Bluthochdruck auf?
Bluthochdruck entwickelt sich häufig schleichend, wodurch Symptome manchmal gar nicht oder so schrittweise auftreten, dass er unbemerkt bleibt. Wenn Beschwerden auftreten, kann es sich dabei um Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit oder Nasenbluten handeln. Wichtig ist, dass man wegen des hohen Komplikationsrisikos auch symptomlose arterielle Hypertonie behandeln sollte.
Hypotonie
Als Hypotonie ist ein arterieller Blutdruck von 100/60 mmHg oder niedriger bezeichnet. Sie kann ebenfalls viele unterschiedliche Faktoren zur Ursache haben. Da sie kaum Komplikationen macht und sogar der natürlichen Blutdrucksteigerung im Alter entgegenwirkt, besteht nur bei Symptomen Handlungsbedarf.
Schock
Im Gegensatz zu der allgemein verstandenen Bedeutung von „Schock“ als Reaktion auf psychische Belastung bezeichnet in der Medizin ein Schock einen lebensbedrohlicher Zustand, bei dem eine unzureichende Gewebedurchblutung und Sauerstoffversorgung zu Organversagen führen kann. Dies resultiert in hypotonem Blutdruck, Gewebehypoxie und metabolischer Azidose (Übersäuerung), was unbehandelt zum Multiorganversagen und Tod enden kann. Man unterscheidet:
- kardiogenen Schock (Herzpumpleistungsversagen)
- hypovolämischen Schock (Blut-/Flüssigkeitsverlust)
- distributiven Schock (Vasodilatation, z. B. septischer oder anaphylaktischer Schock)
- Baenkler et al., Kurzlehrbuch Innere Medizin, Thieme (Verlag), 4. Auflage, 2021
- Behrends et al., Duale Reihe Physiologie, Thieme (Verlag), 4. Auflage, 2021
- Pape H, Kurtz A, Silbernagl S, Physiologie, Thieme (Verlag), 10. Auflage, 2023
- Nationale Versorgungsleitlinie Hypertonie, https://register.awmf.org/... (Abrufdatum 08.02.2025)