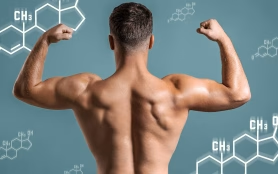Inhaltsverzeichnis
Das Prohormon DHEA wirkt im Körper auf vielfältige Weise, wobei die meisten seiner Effekte auf seinen Folgehormonen beruhen. Dieser Artikel erläutert die Bildung und Wirkung von DHEA und ordnet in diesem Zusammenhang den Einsatz von DHEA im medizinischen und im Lifestyle-Kontext ein.
Inhaltsverzeichnis
DHEA – Definition
Bei DHEA, das ausgeschrieben Dehydroepiandrosteron heißt, handelt es sich um ein körpereigenes Steroidhormon auf der Basis von Cholesterin. Als Prohormon ist es die Vorstufe der Geschlechtshormone. In den Zielzellen wandelt, je nach benötigtem Sexualhormon, entweder die Aromatase DHEA in Östrogene um, oder die 5α-Reduktase synthetisiert daraus Dihydrotestosteron.
Im männlichen Körper produzieren die Nebennieren das gesamte benötigte DHEA, während im weiblichen Organismus die Eierstöcke etwa ein Drittel des Bedarfs abdecken. Dabei besteht eine zirkadiane Rhythmik mit besonders hohen Hormon-Spiegeln am Morgen.
Das Prohormon findet sich hiernach sowohl in seiner wirksamen, freien Form als auch in seiner sulfatierten Form Dehydroepiandrosteron-Sulfat im Blutkreislauf und gelangt damit zu den Zielgeweben und -organen. Sulfatiertes DHEA ist wesentlich länger stabil als das freie Äquivalent und dient als Speicherform, aus der bei akutem Bedarf schnell neues Hormon freisetzbar ist. Es eignet sich entsprechend besser für diagnostische Testungen, da seine Blut-Spiegel konstanter sind als bei der freien Form.
International gebräuchlich im medizinischen und pharmazeutischen Kontext sind zudem die Synonyme „Dehydroisoandrosteron“ und „Prasteron“. Letzteres kommt vor allem bei Angaben zur Zusammensetzung von Medikamenten und Nahrungsergänzungsmitteln zum Einsatz.
DHEA – Wirkung und Funktion
Als Prohormon wirkt sich es nicht direkt, sondern indirekt durch die daraus synthetisierten Sexualhormone auf die Zielgewebe aus.
Die sulfatierte Form nutzen Mediziner gerne zur Untersuchung der Funktion der Nebennierenrinde. Vor allem bei Verdacht auf eine Unter- oder Fehlfunktion des Gewebes kann eine Bestimmung der Hormon-Spiegel auf das zugrunde liegende Krankheitsbild hinweisen. Gründe für eine Abklärung sind beispielsweise unklare Raumforderungen an der Nebenniere (Tumore unklarer Dignität oder Inzidentaliome) oder eine Virilisierung. Darunter versteht man die Vermännlichung bei weiblichem Phänotyp mit übermäßigem Haar- und Bartwuchs. Unklare Erhöhungen der Sexualhormon-Spiegel (Östrogen und Testosteron), Zyklusstörungen oder der Verdacht auf ein Adrenogenitales Syndroms zählen ebenfalls zu den Indikationen.
Raucher weisen meist niedrigere DHEA-Spiegel auf, was bei der Abklärung zu berücksichtigen ist.
Herz-Kreislauf-System
Auf das Herz-Kreislauf-System besitzen DHEA und die Sexualhormone eher eine schützende Wirkung. Dies ergibt sich zum einen aus den blutdrucksenkenden Eigenschaften der Hormone. Darüber hinaus reduzieren sie das Risiko für Arteriosklerose durch ihre entzündungshemmenden Eigenschaften und eine günstige Beeinflussung der Cholesterinbildung.
Studien weisen zudem auf eine mögliche Steigerung von DHEA-Spiegeln durch körperliches Training hin, wodurch sich die positiven Effekte verstärken könnten. Demgegenüber sind zu hohe Blut-Spiegel der Sexualhormone, vor allem bei übermäßiger externer Zufuhr, eher nachteilig für die Gesundheit der Blutgefäße, da sie in diesem Falle die Entstehung der „schlechten“ LDL-Fettsäuren begünstigen.
Die Knochendichte ist abhängig von DHEA und den Sexualhormonen, was sich in der gesteigerten Rate an Knochenmasseverlusten und Osteoporose im höheren Lebensalter widerspiegelt.Knochendichte
Zentrales Nervensystem
Sowohl freies DHEA als auch seine sulfatierte Form nehmen Einfluss auf das Zentrale Nervensystem. Dabei gehen Wissenschaftler derzeit von neuroprotektiven Eigenschaften des Hormons aus, da DHEA und die nachfolgenden Sexualhormone die Neubildung von Nervenzellen unterstützen. Dies senkt das Risiko für die Entstehung neurodegenerativer Erkrankungen wie Alzheimer ab und könnte zudem die Verläufe derartiger Krankheitsbilder abmildern.
Auch eine antidepressive und angstlösende Wirkung der Hormone scheint hier eine Rolle zu spielen. Ein Mangel an DHEA und vor allem den Androgenen geht entsprechend mit einer erhöhten Rate an depressiven Verstimmungen, mit Schlafstörungen und Regulationsstörungen im sozialen Kontext einher. Eine vermehrte Aggressivität könnte ebenfalls hierauf zurückführbar sein.
Glatte Muskulatur
Glatte Muskulatur reagiert auf DHEA und seine Folgehormone mit Entspannung. Dies bewirkt eine Aufweitung der Blutgefäße im Körper, wodurch der Blutdruck sinkt und das Risiko für Kalkablagerungen in den Gefäßwänden reduziert wird. In den Atemwegen könnte eine Verringerung der Muskelspannung die Beschwerden bei asthmatischen Erkrankungen lindern, im Magen-Darm-Trakt positive Effekte auf die Nährstoffausschöpfung und das allgemeine Wohlbefinden haben. Dies ist jedoch noch zu wenig untersucht, um hieraus einen medizinischen Nutzen zu ziehen.
Mobilisierung von Energiereserven
DHEA und vor allem die Androgene fördern den Abbau von Fettgewebe und stellen dem Körper mehr Energie aus den eigenen Depots zur Verfügung. Gleichzeitig besitzen sie anabole Effekte. Sie unterstützen damit die Entwicklung eines athletischen Körperbaus.
Synthetisches DHEA kommt in diesem Zusammenhang nach wie vor als Anti-Aging-Hormon und im Rahmen des Dopings zum Einsatz, obwohl es in Deutschland und einigen weiteren Ländern zu den verbotenen Substanzen zählt und nicht verkehrsfähig ist. Es findet jedoch häufig ein Export aus dem Ausland statt.
Sonstige Effekte
Durch seinen Status als Vorläufer der Geschlechtshormone beeinflusst DHEA indirekt günstig die Sexualfunktion und die Libido. Im Rahmen der medizinischen Therapie wird es als Kombinationspräparat zur Behandlung übermäßig störender Symptome in den Wechseljahren und bei vergleichbaren Zuständen des Hormondefizits eingesetzt, beispielsweise nach der Entfernung der Eierstöcke oder einer Krebsbehandlung mit Ausschaltung der körpereigenen Geschlechtshormonproduktion bei Frauen. Dies ist insbesondere bei vaginaler Anwendung von DHEA von Relevanz, die in einigen Ländern sogar nach Brustkrebserkrankungen befürwortet wird, während die systemische Einnahme von DHEA in diesen Fällen wegen eines erhöhten Rezidivrisikos kritisch gesehen wird. Für Männer existiert derzeit kein medizinischer Einsatzbereich.
Darüber hinaus scheint DHEA durch seine entzündungshemmende Wirkung die Verläufe von autoimmunen Erkrankungen günstig zu beeinflussen. Gleichzeitig stärken ausgeglichene Spiegel der Geschlechtshormone die Funktion des Immunsystems und schützen den Körper vor Krankheiten.
DHEA – Abbau
Der Abbau von DHEA erfolgt, wie bei den daraus synthetisierten Geschlechtshormonen, vorrangig in der Leber. Sie formt DHEA in DHEA-Sulfat um und entsendet es zur weiteren Verarbeitung durch die Organe und Gewebe in die Blutbahn. Überschüssiges Hormon baut sie zu wasserlöslichen Metaboliten ab, welche hiernach die Niere mit dem Urin ausscheiden kann. Dies beugt einem Überschuss an Hormonen vor, der wiederum vor allem bei Frauen massive Beschwerden wie eine optische Vermännlichung des Körpers und Zyklusstörungen auslöst.
Häufige Fragen
- Was ist die Wirkung von DHEA?
- Was erhöht den DHEA-Spiegel?
- Was passiert, wenn der Körper zu viel DHEA hat?
- Wann wird DHEA ausgeschüttet?
Direkte Effekte durch DHEA sind derzeit nicht eindeutig bewiesen. Es handelt sich vielmehr um ein Prohormon, aus dem der Körper die Geschlechtshormone synthetisiert. Damit sind die DHEA Wirkungen letztlich die seiner nachfolgenden Hormone und betreffen unter anderem die Sexualfunktion und darüber hinaus eine günstige Beeinflussung des Herz-Kreislauf-Systems, des Nervensystems und der Blutgefäße.
Neben einer gesunden Lebensweise mit regelmäßiger Bewegung und gutem Schlaf können auch eine hormonelle Fehlregulation, hormonproduzierende Tumoren und eine externe Zufuhr von DHEA die Blutspiegel erhöhen.
Bei Frauen fördert die androgene Wirkung von DHEA die Entwicklung eines männlichen Erscheinungsbildes mit zunehmender Behaarung des Gesichtes und Körpers. Der Zyklus wird gestört, die Menstruation kann ausbleiben. Darüber hinaus wirkt sich ein Übermaß an DHEA bei beiden Geschlechtern negativ auf die Stimmung aus und begünstigt Aggressivität, Schlafstörungen und depressive Verstimmung.
DHEA wird im Rahmen der zirkadianen Rhythmik vor allem in den Morgenstunden ausgeschüttet und bildet die Ausgangssubstanz der lokalen Geschlechtshormonproduktion, sobald es in den Zielzellen aus der sulfatierten in die freie Form umgewandelt wird.
- Hamburger Ärzteblatt (Ausgabe 11/2022)
- Stute, M. D, Die Rolle von vaginalem DHEA bei der Behandlung des genitourinären Syndroms der Menopause, Journal für Gynäkologische Endokrinologie/Schweiz, S. 87-100 (Springer, 25. Ausgabe, 2022)